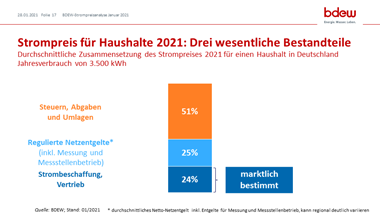In der letzten „Zweitausend50“-Ausgabe schrieb Prof. Dr. Armin Grunwald, die Komplexität der Energiewende sei dramatisch unterschätzt worden – wir hätten uns ein viel zu einfaches Bild vom Energiesystem und von seiner Transformation gemacht. Wie sehen Sie das?
PROF. DR. FRANK BRETTSCHNEIDER — In Umfragen ist die Unterstützung für die Energiewende als abstraktes Konzept groß. Bei konkreten Projekten fehlt es aber oft an Unterstützung. Auch weil die Politik die Komplexität viel zu wenig erklärt. Und dann kommt das NIMBY-Phänomen hinzu – „Not In My Back Yard“. Also: Energiewende ja, aber keine Stromüberlandleitung und keine Windenergieanlage bei mir in der Nähe.
Es gibt also ein Kommunikationsproblem?
PROF. BRETTSCHNEIDER— Ja. Und dieser Vorwurf richtet sich in erster Linie an die politischen Entscheider. Da wurde die Energiewende beschlossen. Erst dann hat man geschaut, was daraus wird, und zwar relativ isoliert: Es geht immer um Einzelaspekte, zum Beispiel die Übertragungsnetzplanung. Was an Verteilnetzen dranhängt, ist dann eine ganz andere Frage. Auch Strom und Wärme werden voneinander abgekoppelt. Es fehlt die große Erzählung: Warum machen wir die Energiewende? Was machen wir da? Und warum können wir darauf stolz sein? Es fehlt auch die Kommunikation der Zwischenerfolge. Gerade beim Mitnehmen und Motivieren wurden wirklich Fehler gemacht.
Sie haben zu Großprojekten wie beispielsweise „Stuttgart 21“ geforscht. Lassen sich Lehren daraus übertragen?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Ja, unbedingt. Die rechtliche Legitimation alleine reicht für die Akzeptanz von Großprojekten nicht mehr aus. Es braucht auch eine Legitimation durch Kommunikation – und zwar von der Grundlagenermittlung bis zur Baufertigstellung. Frühzeitig, kontinuierlich und proaktiv. Am Anfang muss das Ob stehen: Warum brauchen wir eine bestimmte Infrastruktur? Dann kommen die Kriterien für die Beurteilung von Varianten – also das Wie. Erst dann geht es mit der konkreten Ausgestaltung weiter. Da muss ein Schritt auf den anderen aufbauen. Politische Entscheider dürfen sich hier nicht wegducken und die Vorhabenträger im Regen stehen lassen.
Das heißt das für die Kommunikation von Energiewende-Projekten?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Der Ausgangspunkt sind die Energiewende und ihre Begründung. Dann kommt die Umsetzung. Und die ist unglaublich komplex und vielschichtig. Das muss deutlich gemacht werden. Bei jedem Projekt vor Ort muss wieder Bezug auf den Ausgangspunkt genommen werden. Und: Gesellschaftlich tragfähige Lösungen sind nur gemeinsam zu finden – Bürger, Vorhabenträger, Politik und Verwaltung sind gefordert.
Gibt es überhaupt die ideale Kommunikationsstrategie?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Nein, denn die hängt immer von den konkreten Bedingungen eines Projektes ab – von der Vorgeschichte, den örtlichen Begebenheiten, der politischen Situation und so weiter. Da gibt es keine Rezeptlösungen wie aus dem Kochbuch. Deswegen muss am Anfang eine gründliche Analyse stehen.
Welche Fragen müssen da geklärt werden?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Erstens: Wie groß ist der inhaltliche Spielraum bei einem Projekt? Wenn man frühzeitig anfängt, gibt es den meist noch. Dann sollte man auch dialogisch beteiligen. Wenn es keinen Spielraum mehr gibt, geht es lediglich um Information. Zweitens: Wer sind die Stakeholder? Drittens: Welche Themenfelder sind betroffen? Und viertens: Wie sehen Aufbau- und Ablauforganisation aus, wer ist das Gesicht eines Projektes?
Was meinen Sie mit „Themenfeldern“?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Jeder verbindet mit einem Projekt andere Themen. Darüber muss man sich klar werden. Wir empfehlen, eine Themenlandkarte anzufertigen mit verschiedenen Dimensionen – etwa der ökonomischen und der technischen – und darauf die konkreten Themenfelder festzuhalten. Das hilft, denn oft gibt es zu Beginn eine gewisse Betriebsblindheit.
Ein Beispiel?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Ein gutes Beispiel ist der Bau der Justizvollzugsanstalt im schwäbischen Rottweil. Da achtete das Justizministerium vor allem auf „vollzugliche Belange“ wie die Nähe zum nächsten Gericht. Das Finanzministerium achtete auf die Kosten, den Bauuntergrund, die Zufahrtsmöglichkeiten. Für den Oberbürgermeister zählten zum Beispiel die Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Und der NABU fragte nach den Eingriffen in die Natur. Alle diese Aspekte sind wichtig, nicht nur die eigenen. Nachdem man sich das klargemacht hatte, war ein sehr wichtiger Schritt für eine gesellschaftlich tragfähige Lösung getan.
Lässt sich so Eskalation verhindern?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Dafür gibt es keine Garantie. Aber wenn man anfängt zu kommunizieren, bevor die Fronten verhärtet sind, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass es keine Eskalation gibt. Das zeigt das Beispiel der Justizvollzugsanstalt: In Rottweil kam es sogar zu einem Bürgerentscheid. Und 58,4 Prozent stimmten dem präferierten Standort zu. Das hat nur funktioniert, weil es vorher eine ernst gemeinte, gut gemachte dialogische Beteiligung gab.
Kommunikation bedeutet also mehr, als eine Broschüre zu drucken.
PROF. BRETTSCHNEIDER — Bei den älteren Vorhaben wurde Kommunikation oft als platte PR verstanden. Richtig viel gemacht wurde erst, wenn die Eskalation da war – da sollte die Kommunikation dann schnell Probleme lösen. Kommunikation ist aber kein Erfüllungsgehilfe zum Durchsetzen einer Position, sondern eine Managementfunktion. Bei neueren Vorhaben wird das bereits häufiger verstanden. Schon bei der ersten Besprechung gehören die Kommunikatoren an den Tisch. Sie haben einen anderen Blick als Juristen, Ingenieure und Betriebswirte. Das geht damit los, wie man ein Projekt benennt – das hat ja Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung. Bürgerinitiativen sprechen zum Beispiel häufig von „Monster-Trassen“. Damit soll etwas Bedrohliches, Riesiges bezeichnet werden.
Welche Rolle spielen Formate und Kanäle – zum Beispiel soziale Medien?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Die sozialen Medien führen häufig dazu, dass in Konfliktsituationen jeder nur noch in seinem eigenen Kosmos unterwegs ist. Befürworter verstärken sich gegenseitig. Und Gegner tun das auch. Ein sachlicher Austausch wird dadurch erschwert. Und über soziale Medien werden auch Fake News verbreitet. Aber viel wichtiger als soziale Medien sind nach wie vor die Tageszeitungen vor Ort und die direkten Gespräche mit Menschen.
Lässt sich diese „selektive Wahrnehmung“ überwinden?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Wenn Informationen auf ein gefestigtes Überzeugungssystem treffen, wenn Menschen also bereits sehr festgelegt sind, nehmen sie vor allem Informationen auf, die zu ihren Voreinstellungen passen. Zu Beginn eines Projektes gibt es diese festen Voreinstellungen noch nicht. Deswegen ist die frühzeitige Kommunikation so wichtig. Ist das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen, kann Kommunikation nur noch reparieren, aber nicht mehr Einstellungen verändern.
Sie sagen, „Augenhöhe“ sei ein wichtiges Kriterium für erfolgreiche Kommunikation. Was heißt das?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Dialog darf kein Pseudo-Dialog sein. Das merken Menschen, und dann fühlen sie sich zu Recht verschaukelt. Und es gibt eine operative Seite von „Augenhöhe“ – das ist das Format etwa einer Bürgerinformationsveranstaltung. Nicht auf Augenhöhe sind Frontalformate, bei denen Vorhabenträger von einer Bühne herab auf die Zuhörer einreden. Da sind Marktplatz-Formate mit Ständen zum Austausch sehr viel besser geeignet. Auf Augenhöhe heißt auch, Expertensprache in Laiensprache zu übersetzen.
Kann man den Dialog auch in den digitalen Raum verlagern?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Verlagern auf gar keinen Fall: Live muss sein. Es ist viel glaubwürdiger, wenn Menschen sich begegnen und austauschen. Aber die Online-Komponente ist für die Transparenz und zu Dokumentationszwecken wichtig. Alles, was offline stattfindet, soll für andere zugänglich sein. Dazu gehören zum Beispiel Protokolle und Planungsunterlagen.
Macht Kommunikation nicht alles viel komplizierter?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Einfach ist das nicht. Aber es nicht zu machen, macht es noch komplizierter. Dann haben Sie viele Einwände im Planfeststellungsverfahren, Projektverzögerungen, Klagen. Nicht Bürgerbeteiligung bremst die Energiewende aus, sondern das Gegenteil.
Belegt Ihre Forschung das?
PROF. BRETTSCHNEIDER — Wir führen gerade eine Umfrage unter Vorhabenträgern durch. Bisher ist das Bild eindeutig: Zwei Drittel der Befragten sagen, dass ihre freiwillige Kommunikation und ihre Beteiligungsangebote den Projektverlauf positiv beeinflusst haben. Und ebenfalls zwei Drittel sagen, dass der Nutzen die entstandenen Kosten überwiegt.
Das Interview führte Christiane Waas
Prof. Dr. Frank Brettschneider ist Professor für Kommunikationswissenschaft, insbesondere Kommunikationstheorie, an der Universität Hohenheim. Er ist Vorsitzender des VDI-Richtlinienausschusses „Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planung und Bau von Infrastrukturprojekten" und wissenschaftlicher Berater der Bundesnetzagentur.
„Verständlichkeit ist die Grundlage für Austausch“
Ob Pressemitteilung oder CEO-Rede: Mit einer Software berechnet Brettschneider den „Hohenheimer Verständlichkeits-Index“ für alle möglichen Texte. Ein Negativ-Beispiel? „‘Wir streben für das nächste Jahr die Entwicklung zum Nutzfahrzeugvollsortimentshersteller an.‘ Ein zusammengesetztes Monsterwort!“ Positiv sei hingegen, dass Fachbegriffe immer öfter erklärt werden. Die wichtigste Regel? „Ein Gedanke – ein Satz.“ Und sein Tipp für die Kundenkommunikation? „Die Kunden direkt ansprechen, Passivkonstruktionen vermeiden. Wesentlich besser als ‚Eine Bestellung konnte aktuell nicht ausgelöst werden‘: ‚Es tut uns leid, im Moment können Sie nichts bestellen.‘“