Bezahlbare und saubere Energie ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wir brauchen die Energiewende, um den Klimawandel und die globale Erwärmung zu stoppen – und um im Jahr 2050 nachhaltige Energie für eine Weltbevölkerung von dann fast zehn Milliarden Menschen bereitzustellen. Zweifelsohne trägt die Energiewende nicht nur dazu bei, die Treibhausgasemissionen zu verringern, sondern auch die Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung einzudämmen. Damit wird die sogenannte menschliche Sicherheit verbessert. Dieser 1994 von den Vereinten Nationen erstmals definierte Sicherheitsbegriff stellt den Menschen, seine Rechte und sein Lebensumfeld in den Mittelpunkt.
Für Entwicklungsländer wiederum bieten Erneuerbare-Energien-Projekte große Chancen für die soziale, wirtschaftliche und letztlich auch politische Teilhabe bisher marginalisierter Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus werden der Energiewende aber auch positive Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen zugesprochen. Energiewende plus menschliche Sicherheit ist gleich eine friedlichere Welt: Ist dieser - naheliegende - gedankliche Dreisprung wirklich richtig?
Öl und Gas als Vehikel für politischen Druck
Der Optimismus, dass die Nutzung erneuerbarer Energien die Welt konfliktärmer macht, speist sich aus Analysen wie etwa des Hampshire-Professors Michael T. Klare, der die kriegerischen Auseinandersetzungen am Golf vor allem mit dem Kampf um die knappe Ressource Öl in Verbindung setzt. Auch die Ölpreiskrisen der 1970er Jahre nährten das Bild von Öllieferungen als politischem Druckmittel. Die Abhängigkeit von dem Treibstoff der Weltwirtschaft und die eigene Verwundbarkeit – ökonomisch und politisch – bei ausbleibenden Lieferungen und Preisausschlägen bestimmte über 50 Jahre lang die nationale Sicherheitspolitik von Staaten. Die US-amerikanische Vorherrschaft im Nahen Osten zur Sicherung der Energiebezüge wurde mit der Carter-Doktrin 1980 integraler Bestandteil des Sicherheitsparadigmas – und Energiefragen wiederum zum integralen Bestandteil kollektiver Sicherheit des Westens, der im Rahmen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam daran arbeitete, die Energiebezüge zu diversifizieren. Der Umstieg auf Erdgas war ein solcher Schritt. Zumindest im deutschen historischen Gedächtnis wurde mit den Erdgasimporten dann auch der Grundstein einer anderen Sicht auf die Wechselwirkung von Energie, Konflikt und Annäherung gelegt.
Wer handelt, führt keine Kriege miteinander
So sehr Erdöl mit dem Negativ der Golfkriege verknüpft sein mag, so stark wirkt hierzulande das Positiv des Erdgas-Röhrendeals zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland nach. Dieser Deal war eine tragende Säule der Entspannungs- und Ostpolitik. Die Geschichte der Pipelines von den russischen Gasfeldern nach Westeuropa hat die Vorstellung von wechselseitigen Abhängigkeiten begründet. Energie wurde damit in den Kontext einer politischen Annäherung gestellt, denn die Lieferungen schaffen langfristige Beziehungen, bauen auf Kommunikationskanäle und zwingen zum langfristigen Interessenausgleich zu beiderseitigem Vorteil. Wer handelt, führt keine Kriege miteinander - dieses Paradigma hat durch den Kalten Krieg, bis über die Wiedervereinigung und durch die russisch-ukrainischen Gasstreits 2006 und 2009 getragen.
Nord Stream 2: In die Röhre geschaut?
Nun aber hat das positive Bild mit dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 Risse bekommen. Dieser Röhrendeal lässt sich nicht so einfach als Entspannungsprojekt verbuchen, denn er hat Rückwirkungen auf die Ukraine. Zudem haben sich die deutsch-russischen Beziehungen seit Projektbeginn massiv verschlechtert; trotz beiderseitigen Bekenntnissen zur Erdgaspipeline durch die Ostsee. Die kausalen Wirkzusammenhänge zwischen Energie- und Geopolitik sind also komplex. Gemeinsame Energieinfrastrukturprojekte und gemeinsamer Handel können kooperative Trends verstärken, aber von ihnen eine Trendumkehr zu erwarten, hieße wohl, sie zu überfrachten. Sicher aber erhöhen funktionierende gemeinsame Energieprojekte die Negativeffekte, die mit einer massiven Verschlechterung und Zerrüttung des Verhältnisses einhergingen. Zusammenfassend gilt dann wohl eher, wovon politikwissenschaftliche Theoriemodelle ohnehin ausgehen: Nämlich, dass sich Energie und internationale Beziehungen in ihrer Tendenz zu Kooperation oder Konflikt eher wechselseitig verstärken. Was heißt das nun für die Transformationsphase und die neue Energiewelt?
Nachhaltige Sicherheit als Dividende der Energietransformation
Die Energiewende ist eine Herkulesaufgabe, denn Versorgungssicherheit muss auch in der Übergangsphase vom konventionellen Energiesystem in ein nachhaltigeres Energiesystem gewährleistet werden, ohne dabei das alte System zu perpetuieren. Für die internationalen Energiebeziehungen heißt das nichts anderes, als dass Lieferungen so lange durch die Exportländer vorgehalten werden müssten, bis sich das Importland sicher umgestellt hat. So gesehen, werden die Kosten und Risiken auf die Exportländer verlagert. Oder liegt nicht die viel größere Bringschuld einer schnellen Transformation im Einklang mit den kommunizierten Klimazielen bei Importeuren wie Deutschland und der EU? Solche parallel laufenden Überlegungen machen deutlich, wieviel Konfliktpotential sich in der Transformationsphase zwischen Exporteuren und Importeuren anhäufen kann. Gleichzeitig geht mit dem Auslaufen stabiler Lieferbeziehungen ein langfristiger Kooperationskanal verloren. Daher gibt es gute Gründe dafür, die heutigen großen Öl- und Gasproduzenten in eine nachhaltigere Energiewelt mitzunehmen, ihnen somit neue Einnahmequellen durch den Export erneuerbarer Energien zu eröffnen und die Kooperation mit positiven Effekten für die internationalen Beziehungen fortzuführen.
Mehr Sicherheit, bessere Lebenswelten
Bei allen Risiken in der Umbruchphase wird die Energiewende vermutlich doch zu einem Mehr an nachhaltiger Sicherheit führen. Damit wandelt sich auch der (Energie)Sicherheitsbegriff – von der klassischen nationalen Sicherheit hin zu einem Sicherheitsbegriff, der die Differenzierung zwischen Individuum und Gemeinschaft überbrückt und gleichermaßen umspannt. Mag auch die Kausalkette zwischen Energiekooperation und Abwesenheit von Konflikten nicht immer zutreffend sein, so ist doch zu erwarten, dass die Energietransformation die großen Stressfaktoren für internationale Beziehungen wie Klimawandel, Wasser- und Luftverschmutzung adressiert und vor Ort Lebenswelten verbessert. International also reduziert die Energiewende wohl das Potenzial für (Energie-)Konflikte, aber die Nutzungskonkurrenzen um Land und Wasser werden auf der lokalen Ebene Konflikte verursachen.
Ohne politische Hausaufgaben geht es nicht
Damit die Energietransformation zu nachhaltiger Sicherheit weltweit beiträgt, bedarf es also einer aktiven Politik. Dass sich Frieden dadurch ganz automatisch ergibt, ist weder national noch international zu erwarten, wohl aber können tragfähige Gemeinschaften und Allianzen mit weltweit vernetzten Energieprojekten nachhaltig untermauert werden. In der neuen Energiewelt werden Stromverbünde wichtiger, dort entstehen in synchronisierten Netzen echte Schicksalsgemeinschaften, in denen Chancen und Risiken wesentlich symmetrischer als bisher verteilt und Staaten zu Interessensgemeinschaften zusammengeschweißt werden. Strom wird geopolitisch an Bedeutung gewinnen, da sich über Stromkonnektivitäten die neuen Energiebeziehungen verfestigen. Gleiches wird in naher Zukunft auch für den Wasserstoff und seine Derivate gelten. Während Stromverbünde Regionen ausprägen, erlaubt Wasserstoff eine Vernetzung in konzentrischen Kreisen mit ausgewählten Partnerländern auf der ganzen Welt. Während die alte Energiewelt sehr von der Geologie vorbestimmt war, wird die Energiewelt für 2050 durch technische Möglichkeiten und politische Präferenzen neu kartiert werden. Das birgt große Chancen für eine kluge Politik der nachhaltigen Energieallianzen und eine bessere Welt.
 Biografie
Biografie
Dr. Kirsten Westphal ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) tätig und leitet am Institut für Internationale Energiebeziehungen und Globale Energiesicherheit das Projekt „Geopolitik der Energiewende“. Darüber hinaus ist sie Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates.
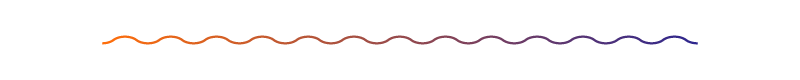
Mehr zur Energiewende
Gasnetze in Europa – Dreh- und Angelpunkt der Energiewende? Zum Artikel
Tiefe Verbundenheit – was Seekabel leisten und wie sie verlegt werden. Zum Artikel
Eine für alles - die EU-Wasserstoffstrategie im Überblick. Zum Artikel
Zurück zur Magazin-Übersicht Europa



