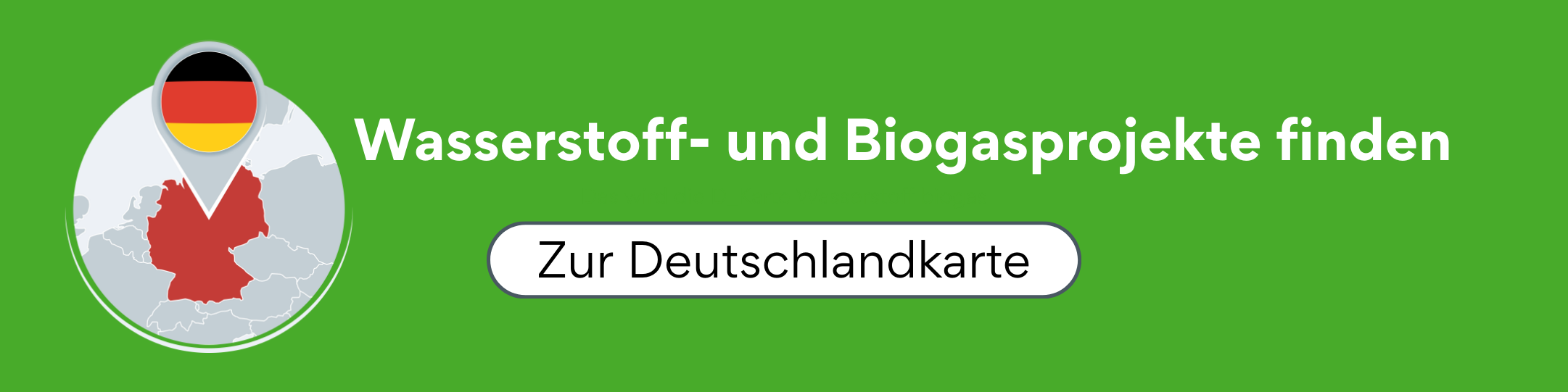Welche Rolle spielt Wasserstoff?
Wasserstoff ist mehr als nur ein Energieträger – er ist das Bindeglied zwischen erneuerbarer Stromerzeugung, sicherer Versorgung und einem innovativen Wirtschaftsstandort. In einer Zeit, in der Versorgungssicherheit, Klimaneutralität und wirtschaftliche Resilienz gleichermaßen gefragt sind, liefert Wasserstoff entscheidende Antworten. Strom- und Wasserstoffnetze gemeinsam bilden zukünftig das starke Rückgrat eines modernen Energiesystems.
Wo kommt Wasserstoff natürlicherweise vor?
Im Gegensatz zu seinem häufig freien Vorkommen im Weltraum liegt Wasserstoff auf der Erde größtenteils in gebundener Form vor. Am weitesten verbreitet ist er in der Verbindung mit Sauerstoff: als Wasser.
Aber auch Energieträger wie Erdgas oder Erdöl sind wasserstoffhaltige Verbindungen. In mehr als der Hälfte aller bisher bekannten Minerale ist Wasserstoff enthalten. In der Erdatmosphäre liegt Wasserstoff gebunden im Wasserdampf vor. Die zur Verfügung stehende Menge an Wasserstoff ist also kein kritisches Problem. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, den Energieträger aus seiner Bindung herauszulösen und zu speichern.
Wie wird Wasserstoff erzeugt?
Wasserstoff ist auf der Erde praktisch nicht in freier Form vorhanden. Mit Wasserstoffherstellung wird die Bereitstellung von molekularem Wasserstoff (H2) bezeichnet. Er muss erst mithilfe bestimmter technischer Verfahren aus bestehenden Verbindungen gewonnen werden, beispielsweise durch Elektrolyse. Für die Spaltung des Wasserstoffes aus den bestehenden Verbindungen in den Verfahren wird wiederum Energie benötigt. Damit ist seine Herstellung nur dann nachhaltig, wenn es die Energiequellen zur Gewinnung auch sind.
Als Ausgangsstoffe eingesetzt werden können
- Erdgas, beispielsweise Methan (CH4),
- andere Kohlenwasserstoffe, beispielsweise Erdöl und Kohle,
- Biomasse,
- Wasser (H2O) oder
- andere wasserstoffhaltige Verbindungen.
Ist Wasserstoff die Lösung für eine CO2-neutrale Energieerzeugung?
Wasserstoff ist ein Energieträger, der bei der Nutzung kein CO2 ausstößt. Klimafreundlich ist er, wenn für seine Erzeugung erneuerbarer Strom eingesetzt wird, da so klimaschädliche Emissionen vermieden werden können. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn gerade kein direkter Bedarf an grünem Strom besteht – also das Angebot die Nachfrage übersteigt. In solchen Fällen kann überschüssiger erneuerbarer Strom zur Herstellung von Wasserstoff genutzt und dadurch speicherbar gemacht werden.
Wasserstoff kann entweder direkt genutzt werden, zum Beispiel in Industrieprozessen. Eine andere Möglichkeit ist, die in Wasserstoff gespeicherte chemische Energie in einer Brennstoffzelle zurück in Strom und thermische Energie umzuwandeln.
Noch gibt es Herausforderungen auf dem Weg zur klimafreundlichen Energieversorgung durch Wasserstoff. Wasserstoff ist beispielsweise ein sehr leichtes Gas und hat dadurch ein enormes Volumen. Ganze zwölf Kubikmeter unverdichteter Wasserstoff entsprechen einem Liter Benzin. Zwar kann Wasserstoff entweder komprimiert oder unter hohem Druck verflüssigt werden, jedoch benötigt dieser Verflüssigungsprozess ebenfalls Energie. Einmal verdichtet wird aus dem Nachteil aber ein Vorteil, denn ein Kilogramm Wasserstoff enthält dann fast so viel Energie wie drei Kilogramm Benzin.
Grafik: Wie wird Wasserstoff erzeugt?
Wie funktionieren die unterschiedlichen Verfahren zur Produktion von Wasserstoff? Die BDEW-Inforgrafik erläutert anschaulich die wichtigsten Fakten.
Die Farben des Wasserstoffs verständlich erklärt
Wasserelektrolyse macht eine emissionsfreie Erzeugung von Wasserstoff möglich, wenn der zur Elektrolyse benötigte Strom aus erneuerbaren Quellen stammt. In diesem Falle wird von “grünem Wasserstoff” oder erneuerbarem Wasserstoff gesprochen. Unter Einsatz von Strom wird das Wasser (H2O) in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Die eingesetzte elektrische Energie wird zum Großteil in chemische umgewandelt und im Wasserstoff gespeichert. Umgekehrt funktioniert die Brennstoffzelle. Sie wandelt die im Wasserstoff gespeicherte chemische Energie wieder in elektrische und thermische Energie um – emissionsfrei.
Im industriellen Maßstab wird Wasserstoff heute hauptsächlich durch Reformierung aus Erdgas erzeugt. Bei der Erdgasreformierung wird zunächst ein Synthesegas (eine Mischung aus Wasserstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserdampf und Restkohlenwasserstoffen) produziert. Kohlenmonoxid kann über eine Konvertierungsreaktion mit Wasser weiter zu Wasserstoff und Kohlendioxid umgewandelt werden. Wasserstoff wird aus dem Gasgemisch abgetrennt. Da hierbei CO2 freigesetzt wird, ist ein auf diese Art und Weise erzeugter Wasserstoff nicht klimaneutral. Wenn das entstandene CO2 nach der Wasserstoff-Herstellung jedoch in geologischen Lagerstätten gespeichert (Carbon Capture and Storage, CCS) oder weiterverwendet wird (Carbon Capture and Utilization, CCU), spricht man von kohlenstoffarmen oder blauem Wasserstoff. Dieser wird als kohlenstoffarm eingestuft, solange das abgeschiedene CO2 nicht anderweitig emittiert wird und kann im Vergleich zu grauem Wasserstoff die Treibhausgasemissionen deutlich reduzieren.
Bei der Methanpyrolyse wird Erdgas, zum Beispiel Methan (CH4), unter Zugabe von Hitze gespalten. Dabei entsteht Wasserstoff und fester Kohlenstoff. Damit das Verfahren CO2-neutral ist, muss die Energieversorgung des Hochtemperaturreaktors aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Außerdem muss der entstehende Kohlenstoff langfristig gebunden oder weiterverwendet werden (CCU), beispielsweise in der Bau- oder Werkstoffindustrie sowie im Straßenbau. Aktuell wird die Methanpyrolyse weiter erforscht. Das Verfahren belastet die Umwelt im Gegensatz zur herkömmlichen Dampfreformierung nicht mit CO2.
Ist es effizient, grünen Strom erst in Wasserstoff umzuwandeln – anstatt ihn direkt zu nutzen?
Wenn eine direkte Nutzung von grünem Strom möglich ist, hat das Vorrang. Steht temporär mehr erneuerbar erzeugter Strom zur Verfügung als verbraucht werden kann (sogenannter Überschussstrom), kann dieser mithilfe der Wasserstofferzeugung speicherbar gemacht werden und so zur Flexibilisierung des Energiesystems beitragen.
In Bereichen, in denen Elektrifizierung physikalisch, technisch oder wirtschaftlich nicht praktikabel oder völlig unmöglich ist – etwa in der Stahlindustrie, bei Langzeitspeichern oder als Prozessgas – ist der Einsatz von Wasserstoff sinnvoll. Dabei darf nicht vergessen werden, dass eine diversifizierte Energieversorgung für eine höhere Resilienz des Gesamtsystems sorgt, wenn sie auf mehrere Energieträger, Transportmöglichkeiten und Importländer setzt. Dieser Grundsatz gilt auch für ein klimaneutrales Energiesystem und erst recht für den Weg dorthin.
Wo kann Wasserstoff eingesetzt werden?
Wasserstoff ist der Schlüssel zur Sektorkopplung. Denn die Energiewende gelingt nur, wenn Strom, Wärme, Mobilität und Industrie enger zusammengedacht werden. Genau hier entfaltet Wasserstoff sein Potenzial: Als speicherbares, flexibel einsetzbares Molekül überbrückt er nicht nur Schwankungen bei Wind- und Sonnenstrom, sondern schafft auch neue Möglichkeiten für eine klimaneutrale Energieversorgung. Ohne diesen Baustein bleibt die Energiewende fragmentiert. Wasserstoff wirkt somit systemintegrierend.
In der aktuellen Debatte um Wasserstoff werden dem Einsatz in der Industrie große Potenziale zugesprochen. Hier gibt es einige Prozesse, die sich nicht oder nur schwierig elektrifizieren lassen. Hier kommt also der direkte Einsatz von erneuerbarem Strom nicht infrage. Aktuell werden für diese Prozesse meist Kohle oder Erdgas genutzt, in Zukunft könnten sie zunehmend auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. Wasserstoff, der durch erneuerbaren Strom in Elektrolyseuren hergestellt wird, kann so beispielsweise in der Stahlindustrie, Chemieindustrie und vielen weiteren Industrien und Gewerbe genutzt werden. Der Wasserstoff kann im bestehenden Hochofenprozess bei der Stahlherstellung die traditionelle Einblaskohle als Reduktionsmittel ersetzen.
Seit mehreren Jahren kann nach dem DVGW-Regelwerk Wasserstoff dem Erdgas beigemischt werden. Das DVGW-Regelwerk erlaubt unter bestimmten Bedingungen auch Wasserstoff-Konzentrationen über 10 Vol.-Prozent bis 20 Vol.-Prozent im öffentlichen Gasnetz. Häusliche Gasgeräte sind nach bisherigem Kenntnisstand bis 10 Vol.-Prozent geeignet. Bezüglich der Eignung bis 20 Vol.-Prozent laufen weitere Untersuchungen (DVGW 2021, PDF). Dabei zeigen bisher vorhandene gut gewartete Geräte in Werkseinstellung keine Auffälligkeiten. Hinzu kommt: Es gibt bereits H2-ready 20 Vol.-Prozent Geräte unterschiedlicher Hersteller, die für eine Beimischung von 20 Vol.-Prozent Wasserstoff im Betrieb ausgelegt sind. In Pilotprojekten wird darüber hinaus die Beimischung von bis zu 30 Prozent%Wasserstoff in bestehende Erdgasnetze erforscht.
Aber auch H2-ready-Brennwertgeräte für zu Hause, die sich mit wenigen Handgriffen von einem Heizungsfachmann vom Betrieb mit Erdgas bzw. Erdgas/Wasserstoff-Gemischen auf den Betrieb mit 100 Vol.-Prozent Wasserstoff umstellen lassen, sind bereits verfügbar. Dazugehörige Umstellset werden von den Herstellern entwickelt und sollen ab 2026 verfügbar sein. Mit etwa einer Arbeitsstunde und somit überschaubaren Kosten soll die Nachrüstung relativ günstig sein.
In der Mobilität gibt es zahlreiche Anwendungen, bei denen rein batterieelektrische Antriebe an Grenzen stoßen – insbesondere im Schwerlastverkehr. Für die Verkehrs- und Transportwende sind daher Elektronen sowie gasförmige und flüssige Moleküle nötig. Dabei erweisen sich erneuerbare und kohlenstoffarme Gase (zum Beispiel Bio-LNG oder Wasserstoff) vor allem dann als gute Lösung, wenn schwere Lasten über weite Strecken befördert werden müssen.
Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge für den Schwerlastverkehr, insbesondere solche mit Brennstoffzellenantrieb, bieten hier eine vielversprechende Alternative. Sie ermöglichen hohe Reichweiten, kurze Betankungszeiten und verursachen – bei Nutzung von grünem Wasserstoff – nahezu keine Treibhausgasemissionen. Auch Wasserstoffverbrenner und hybride Antriebskonzepte, aber auch Bio-CNG und Bio-LNG Fahrzeuge ergänzen die Antriebsoptionen im Schwerlastsegment. Auch für die Luft- und Schifffahrt bietet die Verwendung von Wasserstoff sowie eFuels – also flüssige, synthetisch hergestellte Brennstoffe auf Basis von Wasserstoff und CO2 – großes Potenzial, die Sektoren zu dekarbonisieren. Konkret funktioniert das bei Wasserstoff mit sogenannten Power-to-X-Technologien, bei denen „grüner“ Strom in Gas, Wärme, Kälte oder Kraftstoff gespeichert wird. Das Ergebnis sind eFuels, beispielsweise synthetisches Benzin, Kerosin oder Diesel.
Mit der Speicherung von regenerativem Strom in molekularem Wasserstoff kann Energie mittel- und langfristig gespeichert und in verschiedenen Bereichen genutzt werden. In Zeiten, in denen weniger Strom erzeugt wird, kann der Wasserstoff rückverstromt werden. Das wird in sogenannten H2-ready-Gaskraftwerken geschehen, die ganz oder teilweise mit Wasserstoff betrieben werden. Dies können neue Kraftwerke sein oder bestehende, die bislang fossile Brennstoffe wie Erdgas nutzten und technologisch aufgerüstet wurden.
Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ermöglicht Wasserstoff, dass mithilfe Erneuerbarer Energien alle Sektoren ihre CO2-Emissionen verringern können. Dies wird Sektorkopplung genannt, es beschreibt die energietechnische und energiewirtschaftliche Verknüpfung von Bereichen wie Wärme, Verkehr, Gewerbe, Industrie und Stromerzeugung.
Vor allem in den Bereichen Wärmeerzeugung sowie Industrie und Verkehr bietet die Sektorkopplung großes Einsparpotenzial beim Emissionsausstoß. Bei der Verwendung von Wasserstoff können bestehende Infrastrukturen wie etwa das Gasnetz oder -speicher auch künftig eingesetzt werden.
Gas der Zukunft: FAQ zu Wasserstoff, Biomethan und neuen Gasanwendungen
Wie verändern sich Gasanwendungen in der Energiewende? Jetzt mehr erfahren zur Umstellung auf erneuerbare und CO2-arme Erdgasalternativen.
Wasserstoff als Energiespeicher
Mithilfe von Wasserstoff kann Energie gespeichert, transportiert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder freigegeben werden. Diese Eigenschaft prädestiniert ihn als Speichertechnologie für Erneuerbare Energien. Dieser grüne Wasserstoff kann dann gespeichert oder weitertransportiert werden. Die vorhandenen Speicherkapazitäten für Gas können grundsätzlich auch für erneuerbare und kohlenstoffarme Gase wie Wasserstoff genutzt werden. Ob und in welcher Menge auch andere Erdgasspeicher wie Untergrund-Porenspeicher für Wasserstoff genutzt werden können, wird derzeit noch untersucht. Allerdings kann erneuerbar erzeugter Wasserstoff auch methanisiert und wie konventionelles Erdgas gespeichert werden, wobei bei der Methanisierung Wasserstoff mit CO2 zu speicherbarem Methan umgewandelt wird.
Was beinhaltet die Nationale Wasserstoffstrategie?
Die Nationale Wasserstoffstrategie aus dem Jahr 2020 (Fortschreibung im Jahr 2023) legt unter anderem fest, dass Deutschland bis 2030 mindestens 10 GW Elektrolysekapazität im eigenen Land aufbauen will und zusätzlich große Mengen Wasserstoff importieren muss, um den Bedarf zu decken. Sie unterstreicht die Bedeutung von Infrastruktur (Netze, Speicher, Terminals) und Marktmechanismen und adressiert die Nachfrage in Industrie, Verkehr und Energiesektor. Die Strategie bildet den politischen Rahmen, wobei viele zentrale Fragen - etwa zu regulatorischen Details, zur Umsetzung in der Fläche oder zur Finanzierung außerhalb des Kernnetzes - weiterhin offen sind. Für einen funktionierenden Markthochlauf braucht es allerdings jetzt verbindliche, praxistaugliche und technologieoffene Umsetzungsschritte.
Was ist das Wasserstoff-Kernnetz?
Das Wasserstoff-Kernnetz verbindet Produktionsstandorte, große Verbrauchszentren, Speicher sowie Importpunkte. Zu Letzteren zählen Häfen wie Wilhelmshaven oder Rostock, die als zentrale Knotenpunkte für Wasserstoffimporte dienen. Das Kernnetz umfasst etwa 9.000 Kilometer Leitungen. Rund 60 Prozent dieser Strecke sollen durch die Umstellung bestehender Erdgasleitungen entstehen, während 40 Prozent neu gebaut werden müssen. Die Kosten für den Aufbau des gesamten Netzes werden mit 18,9 Mrd. Euro beziffert, wobei durch die Nutzung vorhandener Infrastruktur erhebliche Einsparungen erzielt werden können.
Bis 2032 sollen die geplanten Maßnahmen umgesetzt und das Netz vollständig in Betrieb genommen werden (abhängig von der zukünftigen Verfügbarkeit von Wasserstoff können die Maßnahmen jedoch bis 2037 zeitlich gestreckt werden). Zudem gewährleistet das Kernnetz die Anbindung an europäische Wasserstoffkorridore, um Flexibilität für den Im- und Export zu schaffen und die Energieversorgung langfristig zu sichern. Europaweit kommen etwa 4.500 Kilometer hinzu ("European Hydrogen Backbone"). Dieses Netz soll bis 2030 erste große Erzeugungs-, Import und Speicherzentren mit den relevanten Abnehmern verbinden.
Wasserstoffengpass ist politisch – nicht technologisch
Trotz technologischer Reife und klarem Willen am Markt bremst aktuell die Regulierung den Wasserstoffhochlauf. Insbesondere für erneuerbaren Wasserstoff führen überkomplexe Vorschriften und kurzfristig greifende Vorgaben zu Mehrkosten, die den Einsatz von Wasserstoff unattraktiv machen. Auch die Rahmenbedingungen für kohlenstoffarmen Wasserstoff führen zu erheblichen Zusatzkosten beziehungsweise verhindern einige Projekte gänzlich.
Die Lücke zwischen Angebotspreis und Zahlungsbereitschaft der Abnehmer kann politisch verringert werden. Mit klaren, praxistauglichen Regeln könnten die Produktionskosten sinken und der Förderbedarf deutlich reduziert werden. Dadurch ließe sich die Nachfrage schneller aktivieren. Die Infrastruktur für Wasserstoff ist mit dem Wasserstoff-Kernnetz auf Hochdruckebene bereits in der Umsetzung. Im Verteilnetz- und insbesondere im Speicherbereich fehlen bisher die politischen Rahmenbedingungen.
Was der Wasserstoffmarkt jetzt braucht: Drei Eckpunkte
Ein funktionierender Wasserstoffmarkt entsteht nur, wenn technische, regulatorische und wirtschaftliche Voraussetzungen gleichzeitig geschaffen werden. Aus Sicht des BDEW sind diese Punkte essenziell:
-
Schließung der Preislücke mit dem Ziel wettbewerbsfähiger Produktionskosten durch weniger Regulierung und einen realitätsnahen Ordnungsrahmen.
-
Gezielte Nachfrageanreize und Absicherungen für Unternehmen, die heute in den Aufbau investieren, damit der Markt morgen funktioniert.
-
Rechtssicherheit und Finanzierungsperspektiven für Infrastruktur auch außerhalb des Wasserstoff-Kernnetzes – etwa für Speicher und Verteilnetze.