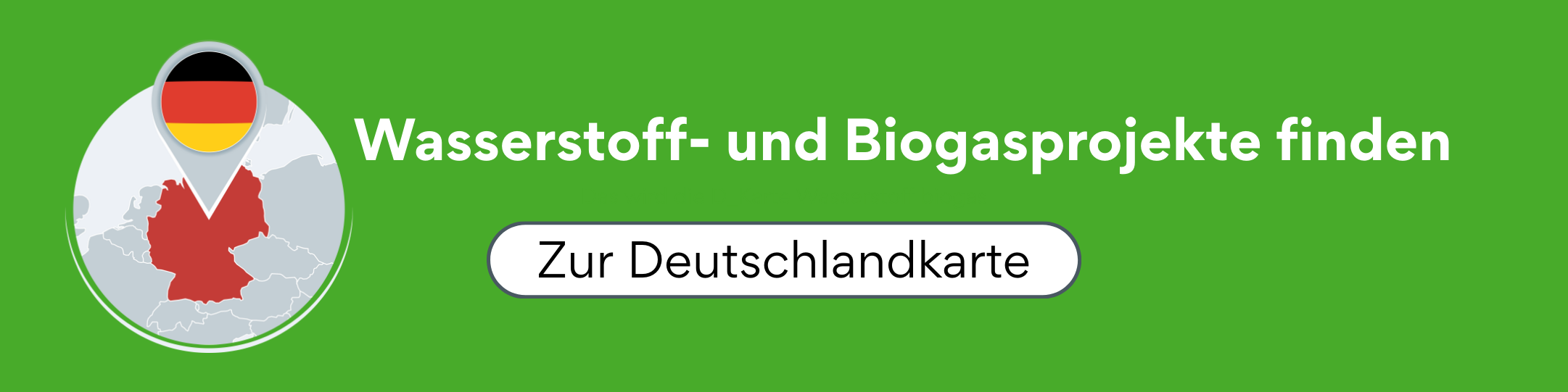Bei der Transformation hin zu Klimaneutralität wird Deutschland, neben dem Ausbau der Erneuerbaren Energien, auf Moleküle als Partner der Erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung angewiesen sein – für einen Zeitraum auf Erdgas und Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG), zudem Biomethan und Bio-LNG sowie Wasserstoff. Die Transformation hin zu Klimaneutralität wird nur erfolgreich sein, wenn das Strom- und das Molekülsystem komplementär und integriert gedacht werden.
Die Nutzung einer möglichst breiten Palette an Energieträgern und Technologien auf dem Weg zur Klimaneutralität erhöht die Resilienz, da dies Handlungsmöglichkeiten und in Krisenfällen Ausweichmöglichkeiten erweitert. Im Bereich Moleküle wird Deutschland – sowie auch die EU als Ganzes – auf Importe aus Drittstaaten angewiesen sein.
Hier gilt es, Fehler aus der Vergangenheit in Form einer übermäßigen Konzentration auf einen Lieferanten nicht zu wiederholen und ein aktives Risiko- und Resilienzmanagement mit Blick auf Lieferbeziehungen und Importabhängigkeiten zu betreiben. Hinsichtlich der Resilienz und der europäischen Energiesouveränität können auch die heimische Produktion von Wasserstoff sowie die Erzeugung von Offshore-Wasserstoff in der Nord- und Ostsee einen Beitrag leisten.
Erdgas und LNG: Moleküle sichern Energieversorgung
Gemeinsam mit politischen Akteuren haben Energieunternehmen einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Energieversorgung in Deutschland und Europa infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in den vergangenen drei Jahren erfolgreich auf ein neues Fundament gestellt werden konnte. Es wurden in kurzer Zeit Lieferbeziehungen zu neuen Gaslieferländern aufgebaut, Vereinbarungen erweitert und LNG-Terminals und die notwendigen Anbindungsleitungen errichtet. Auch in Zukunft muss eine diversifizierte Gasversorgung angestrebt werden, um Konzentrationsrisiken bei einzelnen Lieferanten und Herkunftsländern zu vermeiden sowie die Gasversorgung mit einem Mix an verschiedenen Instrumenten abzusichern. Für die Absicherung sind auch Infrastrukturen und ausreichende Kapazitäten zentral.
Besondere Bedeutung kommt Gasspeichern zu, um Produktions- und Lieferschwankungen, seien sie technischer, ökonomischer oder geopolitischer Natur, ohne Kompromittierung der Versorgungssicherheit auszugleichen. Unabhängig von der Auslastungssituation der LNG-Importterminals können saisonale Nachfrageschwankungen, aber auch Leistungsspitzen, überwiegend durch Speicher ausgeglichen werden. Dadurch tragen Gasspeicher wesentlich zur Stabilisierung und Sicherheit der Energieversorgung bei. Dies ist besonders wichtig in Krisenzeiten oder bei Unterbrechungen der Lieferketten. Ebenso wichtig bleiben die Instandhaltung, Optimierung und der Ausbau von Gasnetzen.
Wie bei der Stromversorgung spielen auch der europäische Energiebinnenmarkt und die Zusammenarbeit in Europa sowie mit verlässlichen außereuropäischen Partnern eine wichtige Rolle. Im Jahr 2024 kam knapp die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Erdgases mit einer hohen Zuverlässigkeit aus Norwegen.
Von Bedeutung in den kommenden Jahren wird auch die kürzlich geschlossene Vereinbarung der EU mit den USA sein, nach der die EU anstrebt, bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump US-Energie im Wert von 750 Mrd. Dollar zu erwerben, mit Fokus auf LNG, Öl und Kernbrennstoffe. Dies kann zur Schließung der Lücke bei EU-Gasimporten dienen, die durch die Umsetzung des Gesetzesvorschlags der EU-Kommission zum Phase-Out von russischen Erdgasimporten voraussichtlich entstehen wird. Es könnte damit das Konzentrationsrisiko steigen, allerdings muss betont werden, dass den Handelsunternehmen von staatlicher Seite nicht vorgeschrieben werden kann, welche Mengen von welchen Lieferanten bezogen werden müssen.
Partnerschaften mit weiteren Gaslieferanten aus verschiedenen Ländern erscheinen zur Risikostreuung sinnvoll. Daneben ist es bei der Umsetzung des Phase-Outs von russischen Erdgasimporten wichtig, die Handhabbarkeit für Unternehmen zu gewährleisten.
Geopolitische Entwicklungen prägen die Gasmärkte entscheidend mit. Dennoch muss die Handlungsmaxime sein, im Sinne der effizienten Ausgestaltung der Gasversorgung den Gashandel den Unternehmen zu überlassen. Dabei braucht es zwischen der Politik und den Unternehmen einen gemeinsamen strategischen Ausblick und realistische Gasnachfrageszenarien, verbunden mit einem verlässlichen Commitment zu Erdgas und LNG als Energieträgern für den Zeitraum bis zur vollständigen Klimaneutralität 2045. Das dient der Anerkennung von europäischen Importeuren als langfristigen Partnern. Dies ist wichtig für den Abschluss langfristiger Lieferverträge. Darüber hinaus sind verlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit für eine erfolgreiche marktliche Beschaffung von Gas bzw. Flüssigerdgas (LNG) unabdingbar.
Wasserstoff: Resilienz und Technologieführerschaft verbinden
Für das Erreichen der Klimaneutralität werden grüne und kohlenstoffarme Moleküle, insbesondere Wasserstoff und seine Derivate, eine zentrale Rolle spielen. Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft eröffnet darüber hinaus das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der europäischen Innovationsfähigkeit und Technologieführerschaft sowie zur Resilienz zu leisten.
Wasserstoff und seine Technologien können jene komplexen Wertschöpfungsketten modernisieren, die für Europas Wirtschaftskraft stehen. Bei Wasserstoffimporten besteht im Vergleich zu Gas/LNG das Potenzial einer viel breiteren Diversifizierung der Herkunftsländer und Lieferanten, mit Akteuren aus Ländern wie beispielsweise Indien, Brasilien und weiteren südamerikanischen sowie nordafrikanischen Ländern. Auch die heimische Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse sowie die Erzeugung von Offshore-Wasserstoff in der Nord- und Ostsee, kann einen Beitrag dazu leisten, die Abhängigkeit von außereuropäischen Produzenten zu verkleinern.
Wasserstoff kann bei Bedarf flexibel eingesetzt werden und damit beispielsweise in der Stromerzeugung eine wichtige Rolle spielen. Kombinierte Anschlusskonzepte aus Seekabeln und Pipelines, die sowohl an das Übertragungsnetz und als auch an das Wasserstofftransportnetz angeschlossen sind, können zudem die Marktintegration der Offshore-Windenergie vertiefen und erhöhen die Flexibilität und Kosteneffizienz des gesamten Energieversorgungssystems.
Pragmatische Rahmenbedingungen für erfolgreichen Wasserstoffhochlauf
Der Hochlauf muss europäisch gedacht werden. Ein großer Teil der relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen wird auf EU-Ebene gesetzt. Diese müssen, insbesondere in den delegierten Rechtsakten für RFNBO sowie kohlenstoffarmen Wasserstoff, pragmatisch, ambitioniert und technologieneutral ausgestaltet werden – hier besteht dringender Anpassungsbedarf.
Deutschland kommt beim europäischen Hochlauf eine Schlüsselrolle zu. Bereits für den Gastransport ist Deutschland jahrzehntelang die Drehscheibe innerhalb der EU gewesen. Auch zukünftig kann Deutschland nicht nur als Verbrauchs-, sondern auch als Transitland für Wasserstoff fungieren. Wichtig dabei ist, dass während der Transformation hin zu Wasserstoff die Gasversorgungssicherheit gewährleistet werden muss, unter anderem mit zusätzlichen Investitionen. Viele EU-Mitgliedsstaaten möchten den Wasserstoffhochlauf ambitioniert vorantreiben. Der BDEW hat deshalb im Rahmen eines breiten Bündnisses von Verbänden aus der Energiewirtschaft eine europäische Wasserstoff-Allianz auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten vorgeschlagen. Ziel ist es, die politische Durchschlagskraft der ambitionierten Mitgliedsstaaten zu bündeln und Fortschritte bei Regulatorik, Handel und Zertifizierung, dem Aufbau des H2-Backbones, sich anschließender Importkorridore sowie Importinfrastrukturen zu erreichen.
Der Aufbau der Infrastruktur und der Anstieg der Nachfrage sind Voraussetzungen für die Entwicklung eines liquiden Marktes. Auf nationaler Ebene ist neben dem Ausbau des Kernnetzes die Schaffung eines Verteilnetzes und die Intensivierung der Nachfrage von hoher Relevanz. Eine kundenorientierte Versorgung funktioniert nicht ohne Speicher.
Wasserstoffuntergrundspeicher sind die physikalische, im Inland potenziell in großem Umfang verfügbare, zum Teil auch regionale, Flexibilitätsquelle. Lange Vorlaufzeiten sowie mangelnde Planungs- und Investitionssicherheit führen jedoch zu einer Investitionslücke. Um den Aufbau (Umrüstung/Neubau) von Wasserstoffspeicheranlagen zu ermöglichen, müssen die erforderlichen Rahmenbedingungen schnell geschaffen werden. Der Markthochlauf kann zudem nur gelingen, wenn Handel und Vertriebe ihr etabliertes Know-how in Portfoliobildung, Fristentransformation und Risikomanagement für Beschaffung und Versorgung mit Wasserstoff anwenden können. Es braucht staatliche Absicherungsmechanismen, die auch von Midstreamern genutzt werden können.
Biomethan als wichtiger Baustein für mehr Resilienz
Auch Biomethan ist ein zentraler Baustein für die Resilienz des Energiesystems. Als erneuerbarer, speicherbarer und netzkompatibler Energieträger kann Biomethan flexibel in bestehenden Gasinfrastrukturen genutzt werden und trägt damit zur Versorgungssicherheit bei. Die heimische Erzeugung von Biomethan reduziert Importabhängigkeiten und die dezentrale Erzeugung in ländlichen Regionen stärkt die regionale Energieautonomie. Darüber hinaus bietet Biomethan durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – etwa in der Strom- und Wärmeerzeugung, im Verkehrssektor oder in der Industrie – eine hohe systemische Flexibilität und sektorübergreifende Nutzbarkeit. Gerade im Kontext der Transformation hin zu einer wasserstoffbasierten Energieversorgung kommt Biomethan zusätzlich eine strategische Brückenfunktion zu.
Als zentrales Transitland im europäischen Gasnetz verfügt Deutschland über eine hochentwickelte Infrastruktur mit grenzüberschreitenden Verbindungen zu zahlreichen EU-Mitgliedstaaten. Diese Rolle kann strategisch genutzt werden, um Biomethanströme aus und in Nachbarländer zu koordinieren und als Drehscheibe für erneuerbare Gase zu fungieren.
Um das volle Potenzial von Biomethan für die Resilienz der Energieversorgung zu heben, sind folgende Schritte notwendig:
- Politische Anerkennung als Resilienzfaktor
- Förderung der Einspeiseinfrastruktur und der Umwidmung bestehender Biogasanlagen
- Koordination mit EU-Nachbarn und
- die Integration von Biomethan in die europäische Gasnetzplanung