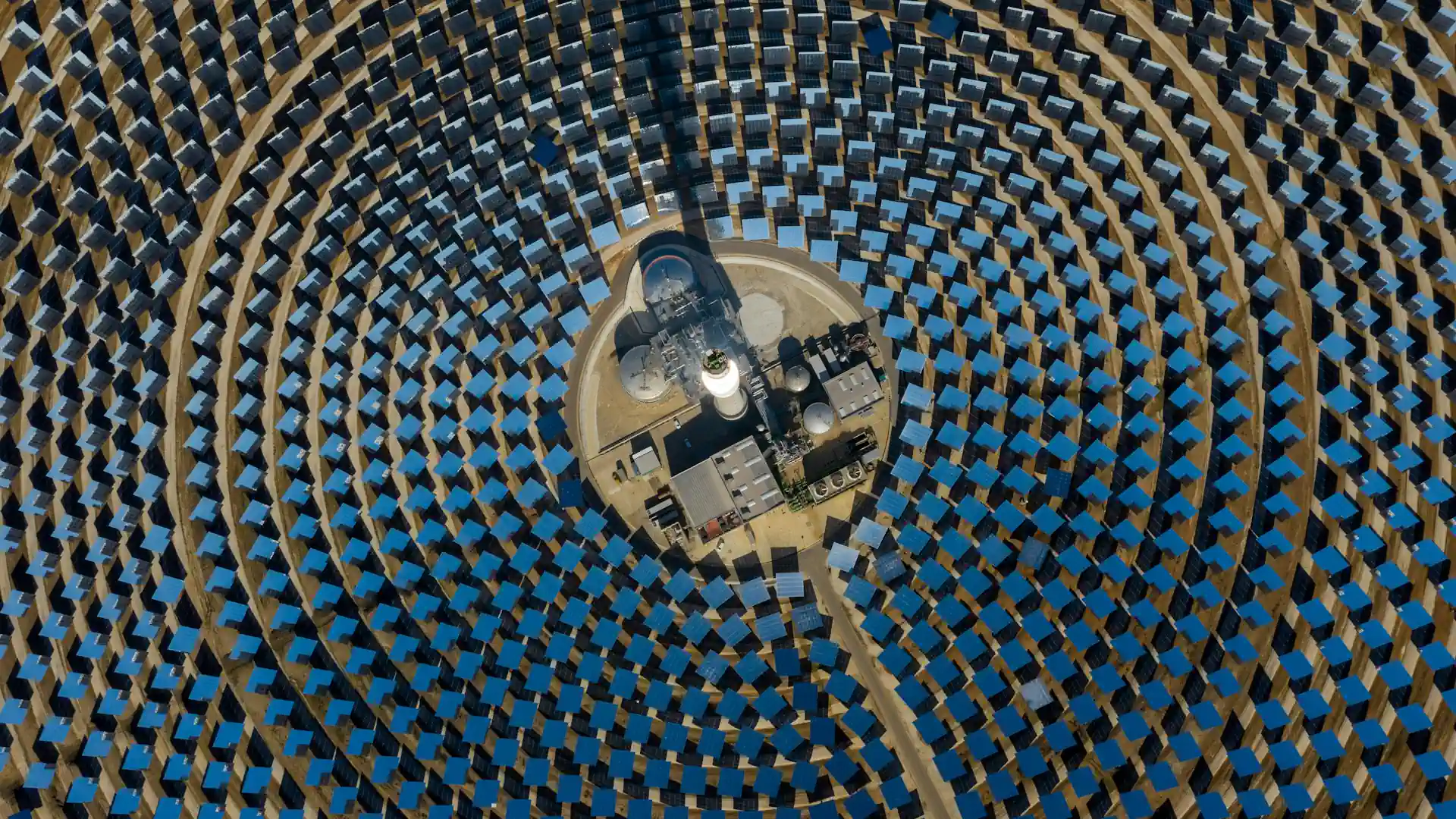Die Erneuerbaren Energien liefern im künftigen Energiesystem den Grundbaustein der klimaneutralen Energieversorgung. Die Transformation der Stromerzeugung hin zu Erneuerbaren Energiequellen hat das Potenzial, die Resilienz des Energiesystems als Ganzes zu erhöhen – auch wenn es hier keinen Automatismus gibt. Ein Grund dafür ist die zunehmende Dezentralität der Stromversorgung, wodurch Ausfälle einzelner Anlagen, beispielsweise aufgrund von Cyberangriffen oder Sabotage, geringere Auswirkungen haben, als es bei wenigen großen Kraftwerken der Fall ist (auch wenn Dezentralität ebenfalls Herausforderungen wie die Notwendigkeit eines flächendeckenden Smart-Meter-Ausbaus mit sich bringt).
Ausbaupfad der Erneuerbaren Energien beibehalten
Es ist essenziell, dass der aktuell festgelegte Ausbaupfad der Erneuerbaren Energien beibehalten wird. Wichtig ist dabei, den Ausbau Erneuerbarer Energien und des Stromnetzes noch besser in Einklang zu bringen und sich stärker am Ertrag und an den Kosten für die Systemintegration zu orientieren.
Mehr digitale Koordination, mehr Speichertechnologien
Gleichzeitig steigt der Bedarf an digitaler Koordinierung und Steuerung von Angebot und Nachfrage, den es in den kommenden Jahren gesichert zu decken gilt. Die Stromerzeugung muss auch in Wind- und Solarmangelzeiten sichergestellt sein, in Zukunft, spätestens ab 2038, ohne Kohlekraftwerke. Dafür ist es essenziell, dass ausreichend gesicherte Leistung vorhanden ist. Die Ausschreibungen für neue (wasserstofffähige) Gaskraftwerke (wie auch Biomethan-kraftwerke) in Deutschland müssen daher so schnell wie möglich erfolgen. In diesem Zusammenhang spielt auch die Kraft-Wärme-Kopplung eine wichtige Rolle. Ab spätestens 2028 ist zum Zweck der Versorgungssicherheit und Resilienz im Strombereich die Einführung eines Kapazitätsmarkts erforderlich.
Darüber hinaus müssen Flexibilitäten, die das Netz und das gesamte Energiesystem stabilisieren und Kosten senken können (wie etwa Batterie-, Gas-, Wasserstoff-, Wärmespeicher und Pumpspeicherwerke), und Technologien der Sektorenkopplung systemisch mitgedacht und durch kluge Marktmechanismen an netzdienlichen Standorten angereizt werden. Eine Beschleunigung der Digitalisierung ist notwendig.
Nicht zuletzt stellt der Umbau der Erzeugung hin zu einem dezentralen, klimaneutralen System die Stromnetze vor große Herausforderungen. Dies betrifft zum einen den notwendigen Netzausbau. Zum anderen müssen jederzeit die notwendigen Systemdienstleistungen zur Verfügung stehen um die Systemstabilität auch in Zukunft zu gewährleisten. Systemdienstleistungen, wie die Schwarzstartfähigkeit von Einspeisern und Batteriespeichern, sind ebenfalls erforderlich, um nach einer Störung die Versorgung wiederherstellen zu können.
Stabile Stromnetze sind Rückgrat der Energiewende
Stabile und sichere Stromnetze spielen eine Schlüsselrolle für die Resilienz der Stromversorgung und sind das Rückgrat der Energiewende. Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse, Cyberrisiken und volatiler Lastflüsse durch Erneuerbare Energien steigen die Anforderungen an robuste und adaptive Netzstrukturen stark.
Auch in einem sich wandelnden Stromsystem mit steigenden Anteilen der Erneuerbarer Energien sind Netzplanung und -betrieb weiterhin so zu gestalten, dass die Versorgung zu jeder Zeit gesichert ist. Hier bedarf es eines systemischen, koordinierten Vorgehens, das Netze, Erzeugung und Lasten in einer integrierten Netzplanung unter Einbezug der Potenziale der Erneuerbaren Energien zusammenbringt. Es ist richtig, dass die Systemeffizienz beim Ausbau von Erneuerbaren Energien und Stromnetzen zunehmend in den Fokus gerückt ist. Diese darf zugleich nicht auf Kosten der Systemsicherheit und -integration und des notwendigen Netzausbaus gehen.
Die Netze müssen nicht nur gegen physische und Cyber-Bedrohungen geschützt, sondern auch an Klimaveränderungen angepasst werden. Insbesondere Starkregenereignisse (durch Dürre und Hitze begünstigte) sowie Brände stellen neue Herausforderungen für die Netzinfrastruktur dar. Um die Netze zu wappnen, benötigen die Netzbetreiber die entsprechenden finanziellen Ressourcen. Wichtig ist ein international wettbewerbsfähiger regulatorischer Rahmen mit einer für Investoren auskömmlichen regulatorischen Verzinsung und Sicherstellung einer adäquaten Abbildung der laufenden Kosten. Das von der EU-Kommission Ende 2025 vorgesehene europäische „Grids Package”, das neben Strom- und Gasinfrastruktur auch Maßnahmen für eine Wasserstoff-Infrastruktur, Offshore-Netze und Projekte von gegenseitigem Interesse (PCIs) mit EU-Anrainerstaaten umfasst, kann hier wichtige Akzente setzen.
Mehr Versorgungssicherheit durch grenzüberschreitende Stromleitungen
Interkonnektoren sind grenzüberschreitende Stromleitungen, die das Übertragungsnetz zweier benachbarter Länder miteinander verbinden. Sie spielen eine zentrale Rolle für die deutsche und europäische Versorgungssicherheit und damit für die Energieresilienz. Eine starke Vernetzung ermöglicht einen effizienten Energieaustausch, insbesondere bei Versorgungsengpässen, und hilft, regionale Überkapazitäten auszugleichen. Das erhöht die Stabilität, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des gesamten europäischen Stromsystems und trägt zur Erreichung der Klimaziele bei, da Interkonnektoren eine optimale Nutzung sauberer Energiequellen unterstützen.
Gut ausgebaute Strominterkonnektoren fördern den innereuropäischen Energiehandel, was die Abhängigkeit von außereuropäischen Energieimporten verringern kann. Der BDEW begrüßt daher auf europäischer Ebene einen weiterhin beschleunigten Ausbau von Interkonnektoren.