Noch vor wenigen Jahren galt die Volatilität von Wind- und Solarstrom als größtes Risiko der Energiewende. Die Frage war scheinbar unauflösbar: Wie halten wir ein System stabil, dessen Hauptquellen wetterabhängig schwanken? Die aktuell geführten Debatten sind voll von Kampfbegriffen wie „Zappelstrom“ und „Dunkelflaute“. Das jedoch ist altes Denken – denn schon jetzt zeichnet sich eine andere Wirklichkeit ab. Leise, schnell und fast unbeachtet hat sich ein Instrumentarium etabliert, das die Lücke schließt: Speicher. Sie sind kein Beiwerk mehr, sondern werden zum strukturbildenden Element eines erneuerbaren Energiesystems. Auf dem Weg zur Energiewende ist Volatilität längst kein Problem mehr, sondern: Bürokratie, ungeeignete Genehmigungsverfahren und nicht zuletzt auch ein Mangel an Optimismus.
Wenn Speicher Erneuerbare planbar machen
Batteriespeicher verschieben Energie zeitlich: Mittags aufgefangene Solarspitzen werden abends zur gesuchten Verfügbarkeit. Das ist systemisch bedeutsam. Netzdienstleistungen, die lange fossil geprägten Kraftwerken vorbehalten waren (Frequenzhaltung, Schwarzstartfähigkeit, Spannungsstützung, Peak Shaving) werden zunehmend belastbar von Speichern bereitgestellt. Auch dort, wo Donald Trump gestrige Parolen wie „Drill, baby, drill“ ausruft, zeigen Märkte mit hohem Erneuerbaren-Anteil wie beispielsweise in Kalifornien im Alltag: Die sogenannte „Duck Curve“ wird zunehmend durch Batteriespeicher abgeflacht, Spitzenlasten sinken, Gaskraftwerke verlieren an Bedeutung. Denn Speicher übersetzen fluktuierende Erzeugung in verlässliche Leistungsbereitstellung.
Deutschland im Fokus: Dynamik weitaus größer als die Modelle
Auch Deutschland durchläuft diesen Wandel schneller als vielen bewusst ist. Schon jetzt sind rund 2,1 Gigawatt netzgekoppelte Großbatterien in Betrieb. 2025 dürfte ein Rekordjahr werden; bis Ende 2026 erwartet die Energieberatungsfirma Modo Energy in einer aktuellen Studie einen Ausbau auf respektable 5,7 Gigawatt. Damit verschiebt sich die Rolle der Speicher zusehends vom experimentellen Pilot- zum relevanten Systembaustein. Der kürzlich erschienene Bericht zur Versorgungssicherheit der BNetzA unterschätzt daher aus meiner Sicht diese Marktdynamik deutlich. Planung, die den Speicherhochlauf nicht ernst nimmt, droht systematisch danebenzuliegen.
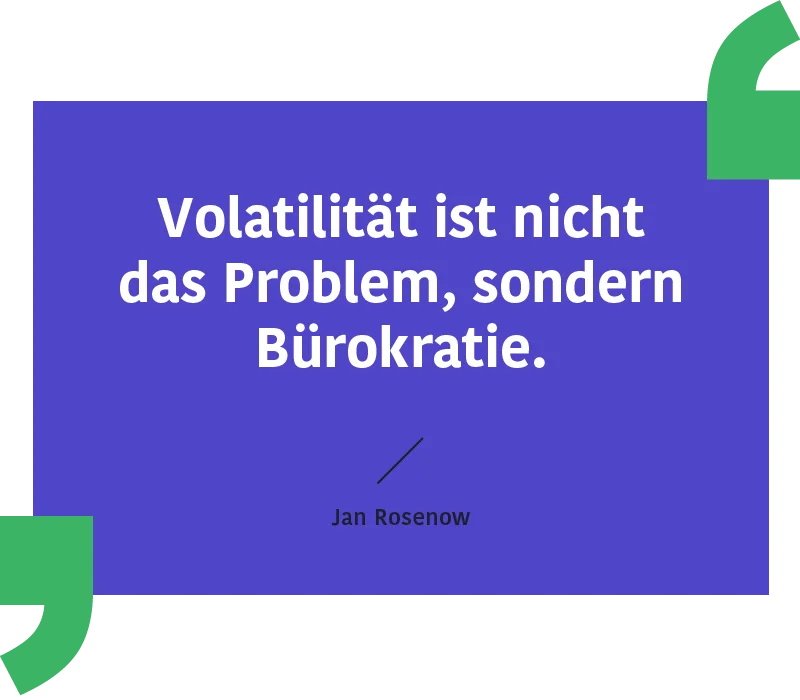
Mehr als Lithium-Ionen: Das Portfolio entscheidet
Batteriespeicher am Umspannwerk sind nur ein Teil. In der Wärmeversorgung entfalten thermische Speicher inzwischen enorme Wirkung. Heißwasserspeicher, saisonale Wärmespeicher und großskalige Power-to-Heat-Lösungen verschieben Energie über Tage bis Monate – zu sehr niedrigen Speicherkosten pro Kilowattstunde. Sie sind der stille Hebel der Sektorkopplung: Fernwärmenetze werden dekarbonisiert, industrielle Prozesse flexibilisiert, erneuerbare Stromspitzen sinnvoll verwertet. Parallel wächst das Potenzial „fahrender Speicher“: Elektrofahrzeuge, bidirektional ladefähig, können perspektivisch Netzdienste erbringen, Lastspitzen glätten und über zeitvariable Tarife zusätzliche Erlöse generieren. Entscheidend ist nicht die eine Wundermaschine, sondern ein klug orchestriertes Zusammenspiel aus elektrochemischen und thermischen Speichern, Flexibilität auf der Nachfrageseite und digitaler Steuerung.
Technologie- und Kostenpfad: Lernen in Echtzeit
Die Kostenkurve arbeitet der Transformation in die Hände. Batteriepreise sind in der vergangenen Dekade deutlich gefallen. Neue Zellchemien drücken die Gesamtkosten weiter. Gleichzeitig professionalisiert sich das Projektgeschäft: Nicht zu vergessen die Kreislaufwirtschaft: Recyclingquoten steigen, Rückgewinnungsketten für kritische Materialien werden aufgebaut. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nähern sich an – eine doppelte Dividende!
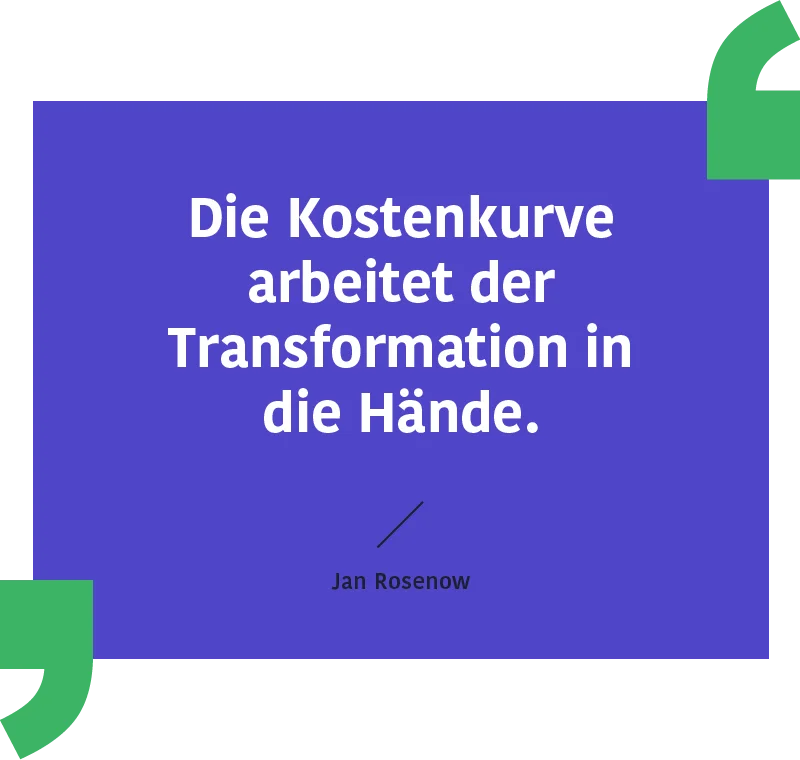
Systemdienlichkeit: Vom Einzelprojekt zur Netzfunktion
Mit der Skalierung verschiebt sich die Rolle von Speichern von der reinen Arbitrage hin zur Systemintegration. Speicher helfen, Redispatch-Kosten zu senken, lokale Engpässe zu entlasten, Blindleistung bereitzustellen und die Resilienz gegen Störungen zu erhöhen. In Kombination mit vorausschauender Netzführung und lokaler Flexibilitätsbeschaffung wird aus der Summe vieler Projekte eine verlässliche Netzfunktion. Dazu gehören klare Signale: Vergütung für Systemdienlichkeit, transparente und technologieoffene Ausschreibungen sowie Netzentgelte, die Flexibilität nicht bestrafen, sondern nutzen.
Nadelöhre: Netzanschlüsse, Verfahren, Marktgestaltung
Die größten Engpässe sind heute nicht technologischer Natur, sondern institutionell. Netzanschlüsse bleiben das Nadelöhr – in Genehmigung, Kapazitätszuweisung und Realisierung. Planungs- und Genehmigungsverfahren sind oft nicht auf die Geschwindigkeit des Marktes ausgerichtet. Marktregeln – von Netzentgelten über Kapazitätsmechanismen bis zur Beschaffung von Regelleistung – definieren, ob Investitionen rechtzeitig erfolgen und Erträge planbar sind. Hier braucht es Tempo: standardisierte Anschlussprozesse, verbindliche Fristen, digitale Verfahren, kooperative Netzplanung und Ausschreibungsdesigns, die Systemmehrwert honorieren. Jede gelöste Engstelle setzt neue Investitionswellen frei.
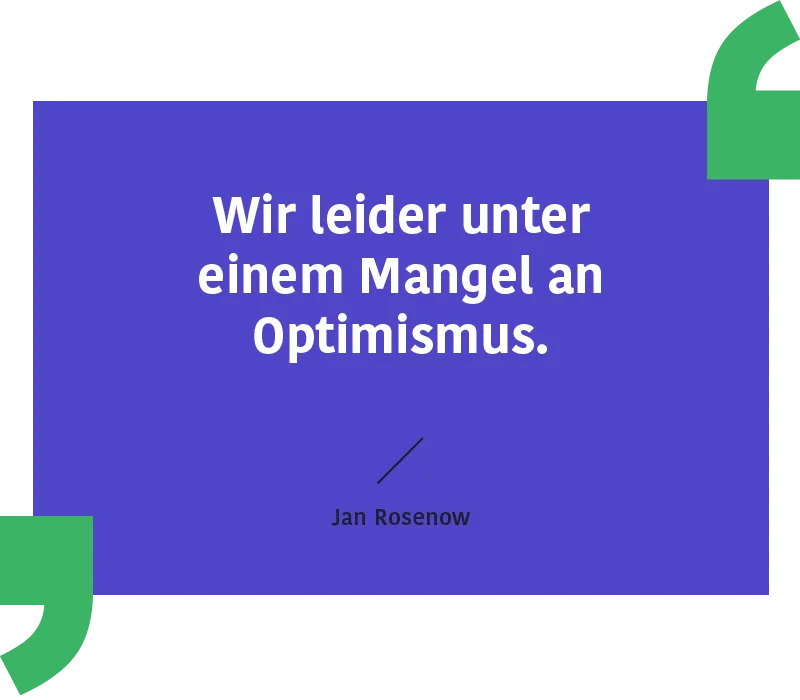
Langzeitspeicher: Brücke über Dunkelflauten
Kurzfrist- und Tagespeicher sind das operative Rückgrat – doch für längere Erzeugungslücken brauchen wir Langzeitspeicher. Hier gilt das Prinzip der Komplementarität: Dort, wo Batterien wirtschaftlich enden, übernehmen Technologien mit niedrigen spezifischen Energiekosten über lange Dauer. Power-to-Gas und Wasserstoff sind zentrale, aber nicht die einzigen Bausteine: Aus erneuerbarem Strom erzeugter Wasserstoff, gespeichert in Kavernen, kann über Brennstoffzellen, Turbinen oder in der Industrie genutzt werden – skalenfähig, saisonal und mit hohem systemischem Nutzen.
Ergänzend kommen Pumpspeicherkraftwerke, Druckluftspeicher und aufstrebende Formen der thermischen Langzeitspeicherung in Betracht, etwa Hochtemperatur-Wärmespeicher, die Strom-zu-Wärme-zu-Strom-Zyklen ermöglichen oder industrielle Wärme bedarfsgerecht bereitstellen. Entscheidend ist die Systemrolle: Langzeitspeicher müssen seltene, aber kritische Ereignisse – Dunkelflauten, langanhaltende Kälteperioden – absichern. Dafür brauchen sie verlässliche Erlöspfade jenseits reiner Arbitrage: Kapazitätsmechanismen, Verfügbarkeitsprämien und klare Regeln für Netz- und Systemsicherheit. So entsteht ein zweistufiges Flexibilitätssystem: Batterien und Wärmespeicher für Stunden und Tage; Wasserstoff und andere Langzeitspeicher für Wochen und Saisonen.
Vom Ausnahmefall zur neuen Normalität
Der Speicherhochlauf ist kein Randereignis, er prägt vielmehr die nächste Ausbaustufe der Energiewende. Je höher der Anteil erneuerbarer Erzeugung, desto wertvoller wird zeitliche und räumliche Flexibilität. Speicher liefern genau das – skalierbar, modular, schnell realisierbar. Wenn wir die institutionellen Engpässe lösen, wird aus dem vermeintlichen Problem der Variabilität ein Standortvorteil: Ein Energiesystem, das sauber, zuverlässig und kosteneffizient ist.
Vielleicht verschwinden dann auch die überstrapazierten Kampfbegriffe von „Technologieoffenheit“ bis „Dunkelflaute“: Es wäre umso mehr zu hoffen, dass die Realität auch Einzug in die Narrative der Energiewende hält. Dann kann aus Vision – endlich! – Praxis werden.
Jan Rosenow
ist Leiter des „Energy Programme“ und Professor für Energie- und Klimapolitik am Environmental Change Institute der Universität Oxford. Außerdem ist er Jackson Senior Research Fellow am Oriel College in Oxford. Darüber hinaus ist er Senior Associate am Cambridge Institute for Sustainability Leadership der Universität Cambridge und gehört als Affiliate Faculty auch zur Universität Sussex.
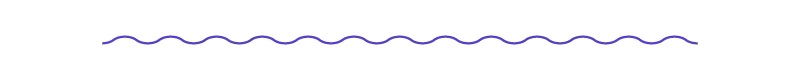
Mehr Gastbeiträge bei Zweitausend50
„Sektorkopplung und ‘Freiheitsenergie’“ – Ein Gastbeitrag von Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Zum Beitrag
„Mit Popkultur zu wrtschaftlicher Macht.“ - Auch Rock’n’Roll machte die USA zur Weltmacht. Wohin solche „Soft Power“ Asien führt, analysiert der Publizist Jens Balzer. Zum Beitrag
„Dezentrale, technologieoffene und pragmatische Strategie“ - Ein Gastbeitrag von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Zum Beitrag
Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Gleichgewicht“


