Warum liefert eine Batterie Strom? Wieso drehen sich die Rotoren einer Windkraftanlage? Und wie schafft es ein Kraftwerk, eine ganze Stadt mit Energie zu versorgen? Die Antwort hat immer mit „Ungleichgewichten“ zu tun – zum Beispiel mit Temperaturunterschieden, mit verschiedenem Luftdruck oder mit elektrischen und chemischen Potenzialen. Solche Unterschiede sind die eigentlichen Antriebskräfte der Energieerzeugung. Indem wir diese gezielt nutzen, können wir sie in Wärme oder Strom umwandeln.
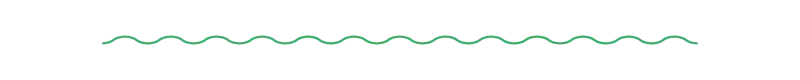
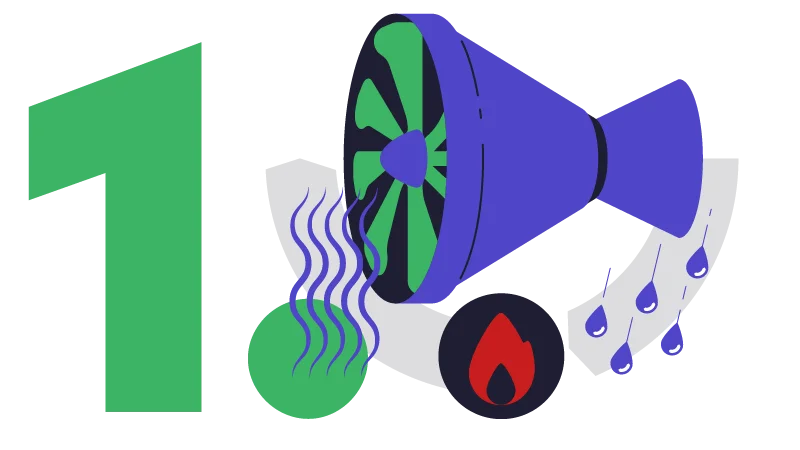 Wärmekraftwerk: Vom Dampf zum Strom
Wärmekraftwerk: Vom Dampf zum Strom
Was hat eine Tasse Kaffee mit einem Kraftwerk zu tun? Beides funktioniert nur, weil Wärme „von warm nach kalt“ fließt – eine Erkenntnis, die Physiker Rudolf Clausius schon im 19. Jahrhundert formulierte.
Im Kraftwerk wird Wasser stark erhitzt, etwa durch das Verbrennen von Gas oder Kohle. Der entstehende Dampf treibt Turbinen an, die wiederum Generatoren bewegen und Strom erzeugen. Anschließend wird der Dampf wieder abgekühlt, damit der Kreislauf von vorn beginnen kann.
Ohne Temperaturunterschied – kein Stromfluss. Deshalb sind moderne Anlagen ständig darauf angewiesen, heiße und kalte Bereiche in Balance zu halten.
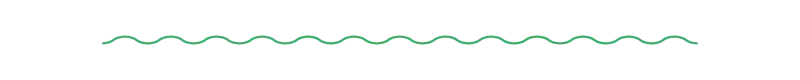
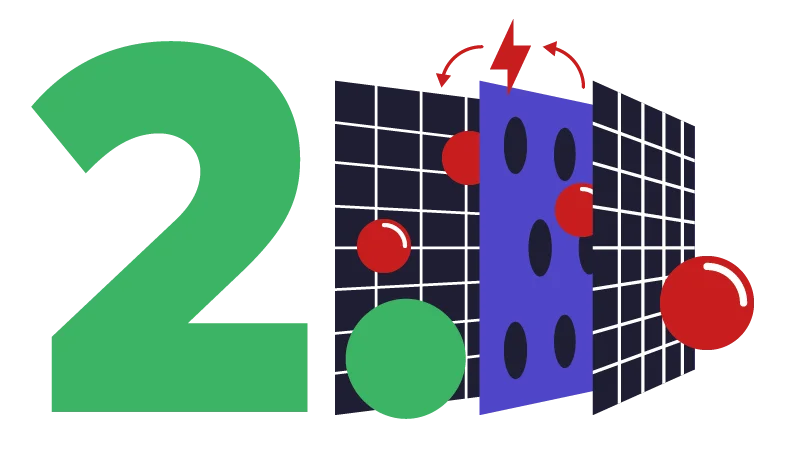 Wasserstoff-Brennstoffzelle: Energiewandler mit Power
Wasserstoff-Brennstoffzelle: Energiewandler mit Power
Wasserstoff-Brennstoffzellen sind wahre Multitalente: Sie können Autos, Züge oder sogar ganze Kraftwerke mit Strom versorgen. Im Inneren der Brennstoffzellen passiert Folgendes: Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff, es entsteht Wasser – und dabei wird Energie freigesetzt, die als Strom genutzt wird.
Ein Prozess, der nur läuft, wenn es Unterschiede im elektrochemischen Potenzial gibt. Der Strom fließt, so lange Wasserstoff und Sauerstoff zugeführt werden und der Stromkreis geschlossen ist.
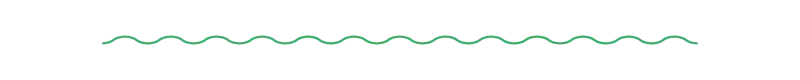
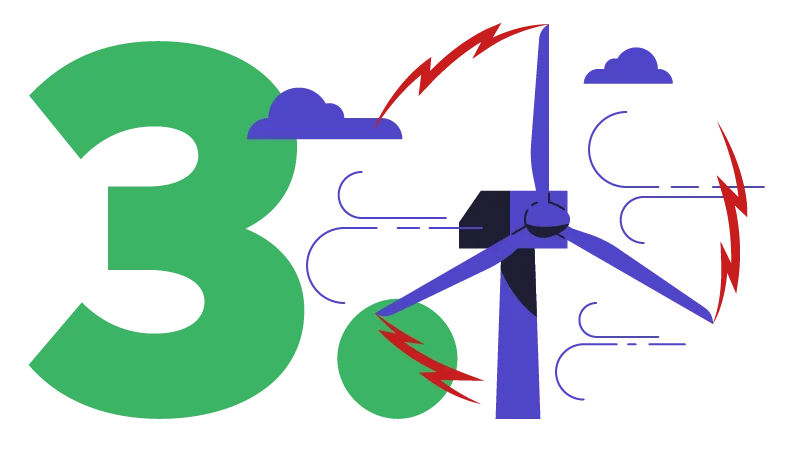 Windenergieanlagen: Mit Luft in Bewegung
Windenergieanlagen: Mit Luft in Bewegung
Mehr als 28.000 Onshore-Windräder drehen sich hierzulande. Ihre Rotorblätter fangen den Wind ein und bringen die sogenannte Nabe zum Drehen. Die mechanische Energie wandelt ein Generator wiederum in Strom um.
Damit der Wind weht, braucht es ein Ungleichgewicht: Differenzen zwischen Temperatur und Luftdruck, die physikalisch ausgeglichen werden wollen. Sie entstehen, weil die Sonne unsere Erde nicht überall gleich stark erwärmt: Landflächen, Wasser oder Berge heizen sich unterschiedlich schnell auf. Luft strömt aus Regionen mit höherem Druck in Regionen mit niedrigerem Druck: Wind entsteht.
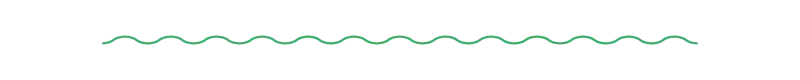
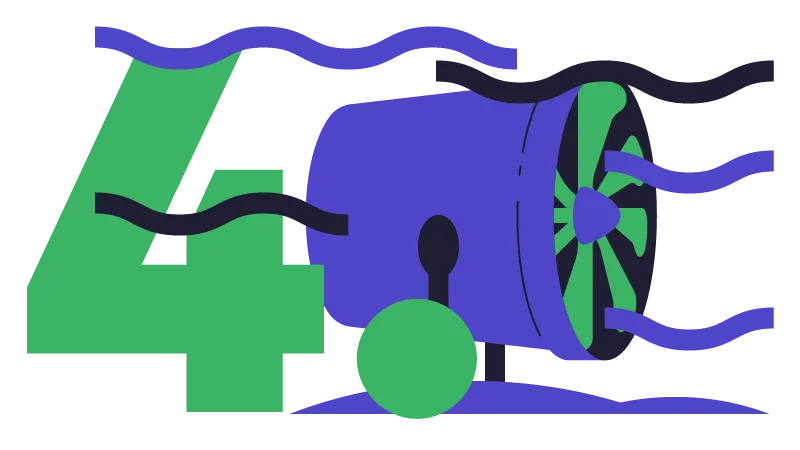 Gezeitenkraftwerke: Der Pegel macht den Unterschied
Gezeitenkraftwerke: Der Pegel macht den Unterschied
Gezeitenkraftwerke gewinnen Energie durch das Auf und Ab des Meeresspiegels: Eine Staumauer hält das Flutwasser zunächst zurück. Fällt der Meeresspiegel bei Ebbe, liegt das gespeicherte Wasser höher als das Meer. Öffnet man die Turbinen in der Staumauer, werden sie durch das ablaufende Wasser angetrieben – Strom entsteht. Sind die Wasserstände im Gleichgewicht, versiegt der Energiefluss.
Wie bei einer Talsperre muss es einen Unterschied im Wasserpegel geben – nur dass dieser nicht durch ein Gebirge, sondern durch die Gezeitenkräfte von Mond und Sonne entsteht.
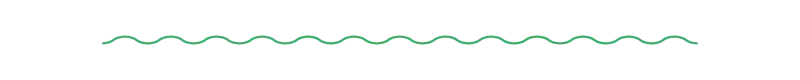
 Batterie: Energie für unterwegs
Batterie: Energie für unterwegs
Batterien sind überall, in Taschenlampen, Laptops oder E-Autos. Ihr Geheimnis: Sie speichern chemische Energie und geben sie als Strom wieder ab.
Und das funktioniert so: Am Minuspol werden Elektronen freigesetzt. Sie wandern außen über den angeschlossenen Stromkreis zum Pluspol – Strom fließt.
Damit alles „im Fluss“ ist, braucht es einen Unterschied in der elektrischen Ladung. Sind alle Elektronen vom Minus- zum Pluspol gewandert, ist dieser Unterschied ausgeglichen – der Stromfluss stoppt.
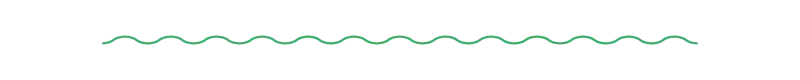
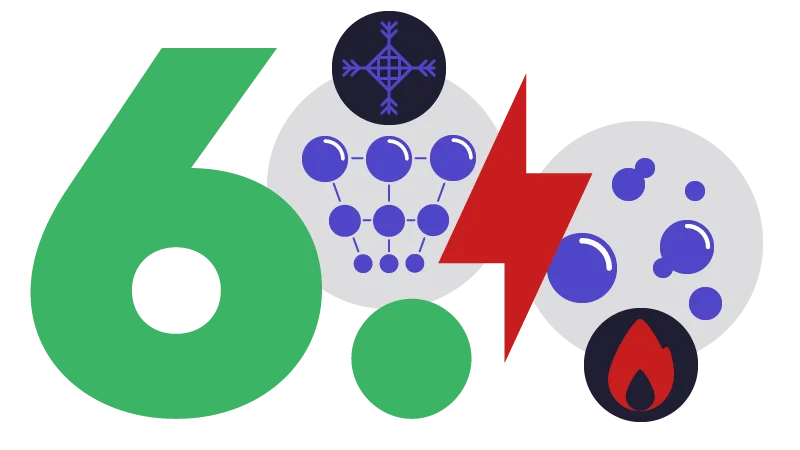 PCMs: Phase wechsle dich
PCMs: Phase wechsle dich
Phasenwechselmaterialien (PCM) sind Meister im Thermomanagement. Sie halten Medikamente in Transportboxen stundenlang kühl oder speichern große Mengen an Wärme.
Sie können ihre Kunst jedoch nur zeigen, wenn es Temperaturunterschiede gibt: Beim Schmelzen nehmen die PCM Wärme auf, beim Erstarren geben sie sie wieder ab – oder umgekehrt. Während dieses Wechsels bleibt ihre eigene Temperatur nahezu gleich. Sie speichern die Energie unsichtbar durch einen Wandel ihrer inneren Struktur.
Ein Prinzip, das wir vom Cocktail kennen: Eiswürfel benötigen zum Schmelzen Wärme, die sie dem Getränk entziehen. Sie selbst verändern ihre Temperatur dabei nicht.
Mehr Listen bei Zweitausend50
Megaprojekte in Asien: Klotzen statt Kleckern – In Asien wird die Energiewende mit erstaunlichem Tempo und kreativen Ideen vorangetrieben. Sechs Beispiele für Megaprojekte. Hier klicken
Visionäre Verkehrsmittel: „Alles einsteigen, bitte!“ – Zu Lande, zu Wasser und in der Luft: Fünf Beispiele für Verkehrsmittel, die ihrer Zeit voraus waren. Mehr erfahren
Was der Markt hergibt – Dinge, die die Welt nicht braucht. Oder doch? Fünf Beispiele für ebenso abseitige wie erfolgreiche Geschäftsideen. Hier klicken
Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Gleichgewicht“


