Vom Stahlwerk bis zum Kindergarten – Deutschland kämpft mit hohen Energiekosten. Frau Andreae, worin sehen Sie die größten Herausforderungen?
KERSTIN ANDREAE: Die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten belasteten Wirtschaft und Verbraucher seit Langem. Das führt zu Akzeptanzproblemen. Zwar sprechen sich die meisten Menschen in Umfragen noch für Klimaschutz und Transformation aus. Wir müssen aber aufpassen, dass uns diese Zustimmung erhalten bleibt. Denn dass wir den Klimawandel bekämpfen müssen, ist unumgänglich. Dafür brauchen wir aber die Gesellschaft und die Wirtschaft.
Wir plädieren daher dafür, neben den kurzfristigen Entlastungen wie bei der Stromsteuer und den Netzentgelten auch im Energiesystem stärker die Kosten- und Systemeffizienz in den Fokus zu nehmen. Hier steckt noch viel Kostensenkungspotenzial.
Herr Rock, wie blicken Sie als Vertreter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes auf die Situation?
JOACHIM ROCK: Unsere größte Sorge ist die wachsende Ungleichheit. Soziale Einrichtungen und Dienste stehen einerseits in einem wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen Einrichtungsformen. Andererseits dürfen sie höhere Kosten für Strom und Wärme nicht in Form höherer Preise weitergeben, da unsere Verbandsmitglieder überwiegend an langfristige Leistungsverträge gebunden sind.
Hinzu kommt, dass gemeinnützige Anbieter laut Gesetz keine nennenswerten Rücklagen bilden dürfen und deshalb kaum über finanzielle Polster verfügen. Unter dieser Situation leiden Beschäftigte ebenso wie die ihnen anvertrauten Menschen.
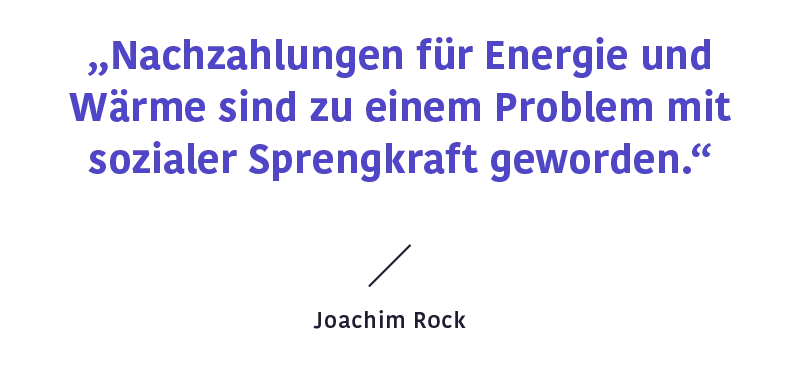
Herr Vassiliadis, als Vorsitzender der IG BCE und dienstältester Gewerkschaftschef in Deutschland – was denken Sie über die aktuelle Lage?
MICHAEL VASSILIADIS: Für die Industrie am Standort Deutschland hat sich eine toxische Mischung ergeben. Auf der einen Seite stehen die Unternehmen wegen der Energiekosten unter Druck. Die sind anderswo signifikant niedriger, und das nutzt der Wettbewerb international genauso aus wie etwa einen privilegierten Zugang zu Rohstoffen. Auf der anderen Seite haben wir denCO2-Preis.
Dieses Modell halte ich in der Theorie zwar nach wie vor für berechtigt, weil es die Dekarbonisierung effektiv steuert. In der Praxis belastet dieses Modell die energieintensiven Branchen aber zusätzlich zu den immensen Energiekosten. Und das hat manche Unternehmen direkt an die Klippe geführt. Wenn es die morgen noch geben soll, muss sich etwas ändern.
Was meinen Sie konkret?
MICHAEL VASSILIADIS: Die Gemengelage ist komplex und verlangt danach, Energiepolitik und Klimapolitik mit einer Vielzahl weiterer Aspekte zusammenzudenken. Da hat Frau Andreae vollkommen recht. Uns als Gewerkschaft geht es im ersten Schritt erst einmal darum, der Öffentlichkeit die Tragweite des Problems deutlich zu machen.
 Michael Vassiliadis
Michael Vassiliadis
ist seit 2009 Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE). Darüber hinaus ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der RAG AG (Herne) sowie Mitglied des Aufsichtsrats der BASF SE (Ludwigshafen), der Henkel AG&Co. KGaA (Düsseldorf) und der Steag GmbH (Essen).
Und natürlich beteiligen wir uns auch an der Debatte, die richtige Lösung zu finden. Manche Vorschläge zielen auf alternative Modelle ab, um den Klimaschutz zu sichern. Anderen Stakeholdern würde es genügen, den besonders energieintensiven Branchen weiterhin kostenlose CO2-Zertifikate zuzuteilen. Eine ähnlich definierte Regulatorik haben wir beim Kohleausstieg ja auch erlebt.
Frau Andreae, wollen Sie das Stichwort Regulatorik aufnehmen?
KERSTIN ANDREAE: Der Auftrag, Lösungen zu sammeln, zu bündeln und anschließend in Regulatorik umzusetzen, liegt eindeutig bei der Politik, nicht bei den Unternehmen. Das sehe ich auch so. Klar ist aber: Wenn wir Wertschöpfung im Land halten möchten, muss der Dreiklang aus Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie harmonisiert werden. Der CO2Preis ist sicher kein Allheilmittel, hat sich aber als marktwirtschaftliches Instrument grundsätzlich bewährt.
Zudem hat sich die Energiebranche mit ihren Investitionen darauf eingestellt. Da sollte es keine Rolle rückwärts geben. Die Stellschraube sehe auch ich vielmehr in einem ordnungsrechtlichen Ausgleich. Das gilt für energieintensive große Unternehmen genauso wie etwa für den Handwerksbetrieb, der Mehrkosten für Mobilität schultern muss. Die entsprechende Förderkulisse muss zielgenau sein, aber keineswegs so fein ziseliert, wie wir uns das in Deutschland angewöhnt haben.
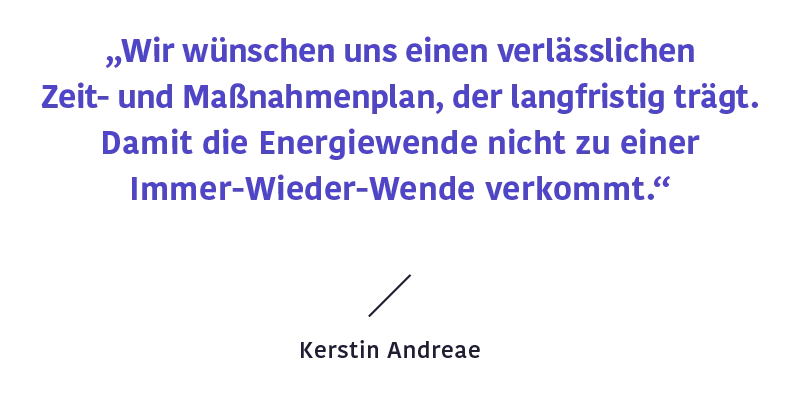
Wir fanden es zum Beispiel hochgradig ungeschickt, im Koalitionsvertrag die Senkung der Strompreise um fünf Cent pro Kilowattstunde zu versprechen. Jetzt stehen zwei Cent in Aussicht. Solche Brüche im Erwartungsmanagement kosten Vertrauen – und ohne Vertrauen sehe ich die Energiewende insgesamt bedroht.
Herr Rock, Sie weisen auf Ungleichgewichte hin. Wodurch ließen die sich mildern?
JOACHIM ROCK: Im Sinne des skizzierten Dreiklangs kommen wir aus unserer Sicht um zwei Maßnahmen nicht herum. Erstens müssen private Haushalte finanziell entlastet werden, vor allem die einkommensschwachen. Die Erhöhung des Wohngelds hat geholfen, löst die Probleme aber allenfalls kurzfristig. Wir müssen beispielsweise an die Steuern ran. Zweitens brauchen soziale Einrichtungen und Dienste in puncto Energieeffizienz Unterstützung und Planungssicherheit. Befristete Zuschüsse wie zu Zeiten der Pandemie helfen auch hier nicht auf Dauer.
 Joachim Rock
Joachim Rock
ist seit 2024 Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Zuvor war er dort Abteilungsleiter für die Ressorts Sozial- und Europapolitik.
Und ich sprach die fehlenden Rücklagen an. Wovon soll ein durchschnittliches Altenheim energetische Sanierungen bezahlen? Dort geht die Heizenergie buchstäblich zum Fenster raus. Und um Frau Andreaes Beispiel Mobilität aufzunehmen: Es ist politisch gewollt und richtig, Fahrzeugflotten zu elektrifizieren. Pflegedienste und unsere notorisch unterfinanzierten Krankenhäuser werden das aber nicht aus eigener Kraft wuppen können.
Härten abfedern, ohne die Transformation an sich in Frage zu stellen – so könnte ein Zwischenfazit lauten. Woher kommt das Geld?
KERSTIN ANDREAE: Die Bundesregierung hat ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen durchgesetzt. Explizit für zusätzliche Investitionen und nicht, um Haushaltslöcher zu stopfen. Ein Fünftel der Summe soll über die Länder an die Kommunen fließen. In unseren Augen wären Investitionen in Energieeffizienz und Modernisierung gut angelegtes Geld.
JOACHIM ROCK: Wir hoffen generell, dass die Bundesregierung nicht an der falschen Stelle spart. Ein Krankenhaus mit seinen stromintensiven Stationen kann einen fixen Bedarf nur bedingt drosseln. Investitionen in die Daseinsfürsorge müssen gesichert bleiben. Bisher lässt uns die Bundesregierung aber ziemlich im Unklaren darüber, wofür die 500 Milliarden im Einzelnen verplant werden.
Gut, es wurden neun Bereiche definiert. Ich sehe aber noch keine stringente Linie und kann noch nicht absehen, wie gerecht es zugehen wird.
Klingt das in Ihren Ohren nach Umverteilung, Herr Vassiliadis?
MICHAEL VASSILIADIS: Ich finde es wichtig und nachvollziehbar, Fragen der Gerechtigkeit aufzuwerfen. Gleichzeitig gilt es in der öffentlichen Debatte immer wieder daran zu erinnern, dass der Staat nur verteilen kann, was durch Wachstum erwirtschaftet worden ist. Mehr als ein Fünftel der deutschen Wirtschaftsleistung hängt an der Industrie und den von ihr angefragten Dienstleistungen. Deshalb warne ich davor, energieintensive Unternehmen mit den Belastungen der Transformation allein zu lassen.
Führen Sie das gerne noch ein wenig aus.
MICHAEL VASSILIADIS: Die energieintensive Industrie ist momentan hochgradig verwundbar. Selbst wenn sie alle Effizienzpotenziale ausschöpft, kann sie den enormen Energiebedarf nicht ausgleichen. Sollten die Belastungen ungebremst weitergegeben, droht die Verlagerung von Produktion ins Ausland – mit dem Effekt, dass Arbeitsplätze verlorengehen und die Emissionen schlicht anderswo anfallen.
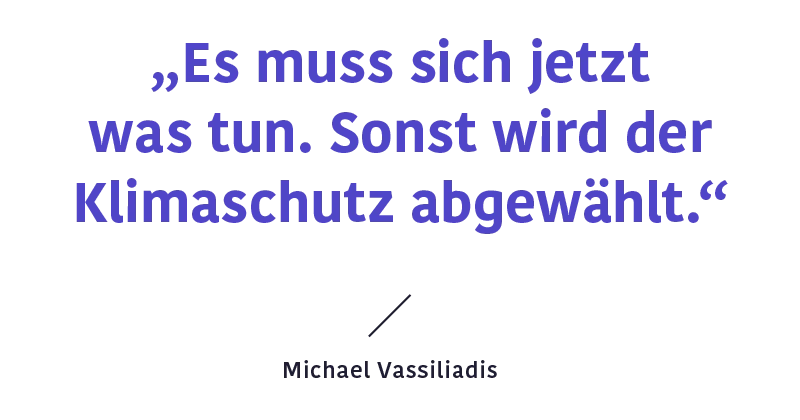
Ein solches Carbon Leakage wäre ökologisch kontraproduktiv und ökonomisch fatal. Deshalb fordern wir Brückenlösungen: verlässliche Rahmenbedingungen, faire Wettbewerbsbedingungen und gezielte Unterstützung, damit die Industrie in Deutschland investiert und zugleich zur Dekarbonisierung beiträgt. Um es plastisch auszudrücken: Ich kann nicht transformieren, was dem Tode entgegensiecht. Ich muss ins Leben investieren.
Wie viel Leben steckt im Energiemonitoring, das Wirtschaftsministerin Reiche Mitte September vorgestellt hat?
JOACHIM ROCK: Erfreulich ist das grundsätzliche Bekenntnis zur Energiewende. Zu hoffen ist, dass sie nun auch Tempo aufnimmt. Denn der Energiehunger nimmt ja eher zu als ab. Zusätzlich zur Stromsteuer will die Regierung die Netzentgelte senken. Beides würde soziale Einrichtungen ab 2026 nennenswert entlasten. Privaten Haushalten blieben um die 150 Euro mehr vom Einkommen übrig. Das ist durchaus beachtlich. Aber wird das reichen?
Das Statistische Bundesamt hat kürzlich vorgerechnet, dass 4,2 Millionen Menschen plötzliche Kostensteigerungen nicht schultern können. Die Einkommen und Ersparnisse genügen nicht. Nachzahlungen für Energie und Wärme sind zu einem Problem mit sozialer Sprengkraft geworden. Wie wäre es also beispielsweise, über die Jobcenter die Anschaffung energieeffizienter Haushaltsgeräte zu ermöglichen? Ich erinnere außerdem an die unselige Debatte um das Heizungsgesetz. Die Menschen bekommen Angst vor ihrer eigenen Immobilie. Das muss man sich mal vorstellen. Wir brauchen also gezielte Förderprogramme für sehr unterschiedliche Branchen und auch für bestimmte private Haushalte.
KERSTIN ANDREAE: Auch die Energiebranche setzt auf zügige Gesetzesinitiativen. Rund um die Energieversorgung, die Systemoptimierung und die Netze steht ungeheuer viel an. Wesentlich wird sein, von diesem betulichen Mikromanagement wegzukommen, das sich eingeschlichen hat. Die Frage ist doch: Wie lässt sich Transformation steuern und zugleich wieder mehr Marktwirtschaft ermöglichen?
Klar ist: Wir wünschen uns einen verlässlichen Zeit- und Maßnahmenplan, der langfristig trägt. Damit die Energiewende nicht zu einer Immer-Wieder-Wende verkommt.
Welche Meinungen hören Sie seitens der Industrie, Herr Vassiliadis?
MICHAEL VASSILIADIS: Planungssicherheit, neue Impulse, Aufbruch – genau darum geht es. Viele Unternehmer und Manager, mit denen ich zu tun habe, waren jahrelang Feuer und Flamme für die Transformation. Auch die Beschäftigten standen größtenteils hinter Plänen zur Modernisierung alter Standorte oder zur Elektrifizierung. Und heute? Überwiegen Ratlosigkeit und Kritik. Die Stimmung ist gekippt. Ein Beispiel: Ich komme gerade aus der Aufsichtsratssitzung einer großen Wohnungsbaugesellschaft im Ruhrgebiet.
Der gehören zahlreiche Bergarbeiterwohnungen, alt und nicht sonderlich geräumig, aber ordentlich. Durchschnittsmiete 6,60 Euro pro Quadratmeter. Um nach einer energetischen Sanierung auch nur geringfügig Rendite zu erwirtschaften, wären 10 Euro nötig. Jetzt haben wir 8,50 Euro beschlossen, werden das also quersubventionieren. Wie die Mieter trotzdem reagieren werden, kann man sich denken. Frustration auf allen Seiten. Es muss sich jetzt was tun. Sonst wird der Klimaschutz abgewählt.
Wie schätzen Sie das ein, Frau Andreae?
KERSTIN ANDREAE: Ungeteilte Zustimmung. Es wird Zeit, dass die Menschen dieses Sondervermögen von einer halben Billion Euro im Alltag sehen und spüren, statt immer nur davon zu hören. Dieses Geld ist ja auch so etwas wie ein Bollwerk gegen das Gefühl, von Amerika verlassen und von China überrumpelt zu werden.
 Kerstin Andreae
Kerstin Andreae
ist seit November 2019 Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW. Zuvor war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende, wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Bundestag und Initiatorin sowie Koordinatorin des Wirtschaftsbeirates der Fraktion.
Hier ein Drill-Baby-Drill-Präsident, dort ein aggressiver Player, der das Thema Erneuerbare und Energieeffizienz ganz pragmatisch und exportgerecht an sich reißt. Die Stimmung ist doch so: Europa droht, als wertegetriebener Musterknabe wirtschaftlich unterzugehen. Richtiger wäre: Mit den Werten wirtschaftspolitisch erfolgreich zu sein.
Zum Abschluss: Fassen Sie bitte in wenigen Sätzen zusammen, was Sie von der Bundesregierung erwarten.
KERSTIN ANDREAE: Als besonders wichtig erachte ich weitere Energiepreisentlastungen. Die Stromsteuer muss runter, und zwar für alle. Wir brauchen außerdem mehr Tempo bei den Gesetzen. Von der Wärmeversorgung bis zum Abbau von Bürokratie. Und: Den Wasserstoffhochlauf nicht nur klimapolitisch, sondern vor allem wirtschaftspolitisch zu verstehen. Wir dürfen hier nicht den Anschluss verlieren.
JOACHIM ROCK: Wir wünschen uns Planbarkeit und ein Ende des Zangengriffs, in dem sich soziale Einrichtungen und Verbraucher in puncto Energiekosten befinden. Energieeffizienz ist machbar. Sie kostet aber Geld. Das muss jetzt in gezielte Maßnahmen fließen.
MICHAEL VASSILIADIS: Unsere Mitgliedsunternehmen kämpfen mit hohen Energiepreisen und CO₂-Kosten. Wenn ihnen dadurch die Luft zum Atmen fehlt, werden sie weder investieren noch Arbeitsplätze halten können. Wir brauchen verlässliche Preise, faire Wettbewerbsbedingungen und gezielte Unterstützung für die energieintensive Industrie. Nur so bleibt sie in Deutschland, trägt zur Wertschöpfung bei und kann gleichzeitig die Dekarbonisierung vorantreiben.
Vielen Dank für das Gespräch.
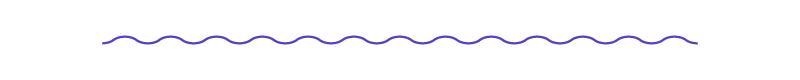
Mehr Round-Table-Gespräche
„Zurück auf Los? Round Table zur Energiewende“ - Kerstin Andreae im Gespräch mit Wolfgang Gründinger, Felix Matthes und Dominik Wirth. Zum Gespräch
„Ist der Kapitalismus noch zu retten?“ – Staatliche Eingriffe oder freies Spiel der Marktkräfte? Kerstin Andreae im Gespräch mit Ulrike Herrmann, Lion Hirth und Klaus Müller. Zum Gespräch
„Wir brauchen eine langfristig angelegte Politik“ – Die Ukraine-Krise befeuert die Energiewende. Kerstin Andreae im Gespräch mit Veronika Grimm und Katrin Suder. Zum Gespräch
Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Gleichgewicht“


