Frau Urbatsch, was versteht man eigentlich unter sozialer Mobilität?
Dabei geht es um die Frage, ob und wie sich der soziale Status eines Menschen im Vergleich zu seinen Eltern verändert. Salopp gesagt: Steige ich eher auf oder ab hinsichtlich Bildungsabschluss, Einkommen und sozialem Status?
Was passiert, wenn es in einem Land eine zu geringe soziale Mobilität gibt?
Es ist natürlich einerseits für das Individuum sehr schade, wenn es weniger Aufstiegs- oder Bildungschancen hat. Das führt zu Frust und Demotivation. Zum anderen ist das aber auch für Staat und Gesellschaft nicht gut. Wenn wir die Potenziale unserer Mitbürger nicht heben, schadet das der Wirtschaft.
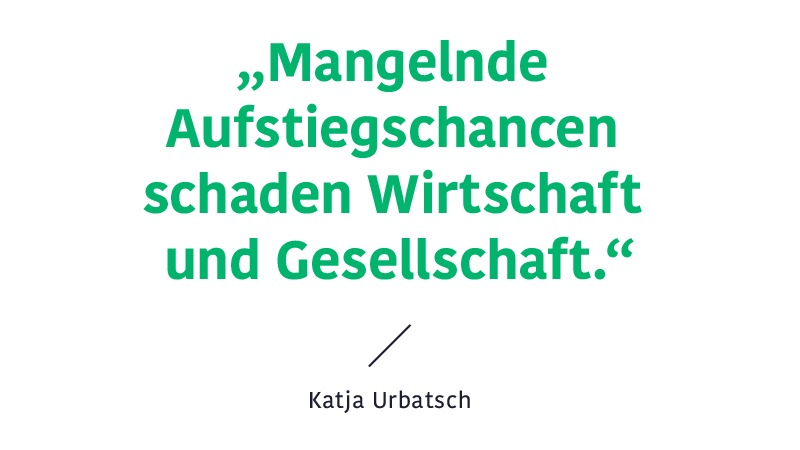 Und wenn Menschen das Gefühl haben, sie könnten nicht an Bildung und Wohlstand teilhaben, dann wächst natürlich auch das Risiko einer zunehmenden Unruhe in der Gesellschaft.
Und wenn Menschen das Gefühl haben, sie könnten nicht an Bildung und Wohlstand teilhaben, dann wächst natürlich auch das Risiko einer zunehmenden Unruhe in der Gesellschaft.
Sie selbst kommen aus einem nichtakademischen Haushalt. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe früh dafür gekämpft, ein Studium zu beginnen, insofern hatte ich zumindest immer eine hohe Motivation und damit keine negativen Empfindungen für mich verbunden. Aber ich habe auch festgestellt, dass die Atmosphäre an einer Universität für mich neu war. Es war ein Stück weit eine fremde Welt. Dabei ging es nicht nur um das reine Bildungsangebot, sondern auch um die Frage, wie man sich artikuliert, wie man mit anderen diskutiert oder wie man sich durch die Bürokratie kämpft. Im Grunde fehlte mir der dafür notwendige Stallgeruch, das musste ich mir erst einmal alles erarbeiten.
Sie haben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen die gemeinnützige Organisation arbeiterkind.de gegründet. Was ist die Zielsetzung Ihrer Organisation?
Wir möchten soziale Mobilität erhöhen, Erfahrungen weitergeben, Menschen aus nichtakademischen Familien einen einfacheren Zugang zu höheren Bildungsangeboten ermöglichen. Ursprünglich haben wir vor 15 Jahren mit einer einfachen Informations-Website angefangen, die war sofort ein Überraschungserfolg. Heute haben wir 80 Lokalgruppen mit Ehrenamtlichen überall in Deutschland, die ganz konkret unterstützen.
Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
Wir gehen beispielsweise in die Schulen und beantworten dort ganz konkrete Fragen. Außerdem gibt es offene Treffen, ein Infotelefon und vielfältige Hilfe bei Fragen der Finanzierung: Viele Menschen können sich unter BAföG oder einem Stipendium nichts vorstellen, da leisten wir Beratungsarbeit und helfen bei der Beantragung.
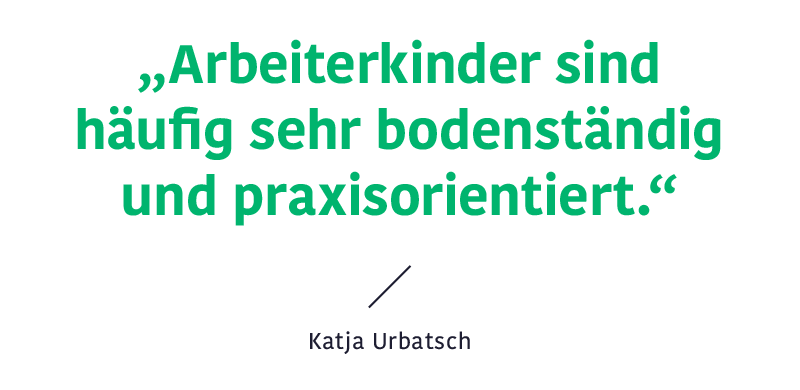 Und: Wir erklären auch, was an der Uni vor sich geht: Wie sieht ein typischer Alltag als StudentIn aus? Wie organisiere ich mich selbst? Was kann ich lernen und worum muss ich mich selbst kümmern? Wer mag, wird auch von einem Ehrenamtlichen „an die Hand genommen“ und man besucht gemeinsam eine Hochschule und schaut sich um. Am Ende geht es um Erfahrungsaustausch, den Abbau von Unsicherheit und die Ermutigung bzw. Ertüchtigung.
Und: Wir erklären auch, was an der Uni vor sich geht: Wie sieht ein typischer Alltag als StudentIn aus? Wie organisiere ich mich selbst? Was kann ich lernen und worum muss ich mich selbst kümmern? Wer mag, wird auch von einem Ehrenamtlichen „an die Hand genommen“ und man besucht gemeinsam eine Hochschule und schaut sich um. Am Ende geht es um Erfahrungsaustausch, den Abbau von Unsicherheit und die Ermutigung bzw. Ertüchtigung.
Was sind die typischen negativen Klischees, die einem „Arbeiterkind“ anhaften?
Für mich gibt es diese Klischees nicht. Wir benutzen das Wort ja auch eher augenzwinkernd. Im Gegenteil: Menschen aus nichtakademischen Familien sind häufig sehr bodenständig und praxisorientiert, haben auch einen besseren Blick auf soziale Schichten. Wer „aufsteigt“, kennt beide Welten und kann zwischen diesen später im Beruf viel mehr vermitteln und damit für mehr Gerechtigkeit sorgen. Aus meiner Sicht sind das unglaublich wertvolle Kompetenzen.
Ihre Organisation ist seit 15 Jahren aktiv, damit haben Sie einen großen Erfahrungsschatz sammeln können. Hat sich in dieser Zeit die soziale Mobilität hierzulande verbessert?
Eigentlich nicht, die soziale Mobilität ist weiterhin gleich schlecht. Allerdings sehen wir immer mehr Menschen, die Abitur machen. Inzwischen hat etwa ein Drittel der Azubis Abitur - was wiederum die Chancen für diejenigen verringert, die kein Abitur machen. Insofern würde ich sagen: Da hat sich bisher nichts Grundlegendes verbessert.
In Migrantenfamilien herrschen oft noch sehr konservative Strukturen, gleichzeitig brauchen wir an allen Ecken und Enden Fachkräfte. Wie kann man junge MigrantInnen erreichen und ihnen eine höhere soziale Mobilität ermöglichen?
Es gibt in diesem Familien häufig überraschend hohe Bildungsambitionen. Was ich eher sehe ist, dass diese jungen Menschen in unserem Bildungssystem Diskriminierung erfahren. Viele möchten Abitur machen, möchten etwas aus sich machen, aber wir geben ihnen keine Chance. Und es gibt pro Jahr etwa 300.000 Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden oder als nicht ausbildungsfähig abgestempelt werden. Wir dürfen nicht erwarten, dass diese Menschen schon alles können. Wir müssen in ihre Bildung und auch in ihre Ausbildung investieren. Ich bin sicher, dass sich das am Ende für alle lohnt.
Gibt es Länder, die eine beispielhaft hohe soziale Mobilität hinbekommen – und was können wir davon lernen?
Die skandinavischen Länder sind da grundsätzlich sehr weit vorne. Dort wird deutlich mehr in Bildung investiert: Das beginnt bei der Personalbemessung, die individuellere Betreuung ermöglicht und setzt sich fort bei einer staatlichen Grundförderung für Studierende. Übrigens hat in den skandinavischen Ländern der Berufsstand der LehrerInnen und ErzieherInnen auch ein viel höheres Ansehen als hierzulande.
Was kann grundsätzlich getan werden, um soziale Mobilität zu verbessern?
Wir müssen uns erst einmal klarmachen, dass es Menschen gibt, die von ihren Familien keine Unterstützung bekommen können. Ich habe häufig den Eindruck, dass wir diesen Menschen implizit Vorwürfe machen. Wir sollten das aber akzeptieren, gerade die Privilegierten unter uns. Der Staat wiederum muss mehr in die Bildungsinstitutionen investieren: mehr Lehrerinnen und Lehrer, Mentoringprogramme, mehr frühzeitige Unterstützung alternativer Bildungswege.
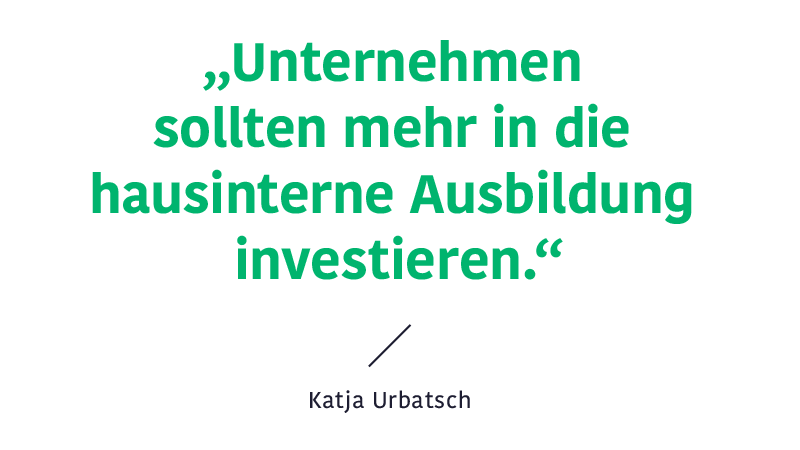 Auch die Unternehmen können und müssen sich einbringen – indem sie verstärkt inhouse ausbilden und für diese wertvolle Arbeit Zeit und Ressourcen allozieren. Zu guter Letzt brauchen wir als Gesellschaft ein anderes Mindset. Mal etwas zugespitzt gesagt: In den USA heißt es „Live your dream“ und bei uns „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“
Auch die Unternehmen können und müssen sich einbringen – indem sie verstärkt inhouse ausbilden und für diese wertvolle Arbeit Zeit und Ressourcen allozieren. Zu guter Letzt brauchen wir als Gesellschaft ein anderes Mindset. Mal etwas zugespitzt gesagt: In den USA heißt es „Live your dream“ und bei uns „Schuster, bleib bei deinen Leisten.“
Was ist Ihr persönliches Resümee nach 15 Jahren arbeiterkind.de und wie blicken Sie in die Zukunft?
Wir haben erreicht, dass wir viele Menschen unterstützen können, dass wir ein Bewusstsein geschaffen haben für soziale Ungleichheit. Gleichzeitig mache ich mir aktuell große Sorgen, weil gerade viel zusammenkommt: großer Finanzdruck, Inflation, hohe Mietpreise und Lebenshaltungskosten. Viele Studierende müssen gerade kämpfen. Ich wünsche mir, dass die BAföG-Reform vorankommt und dass das Bafög Schritt hält mit den reellen Kosten.
Frau Urbatsch, vielen Dank für das Gespräch.
Katja Urbatsch
ist Gründerin und hauptamtliche Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation ArbeiterKind.de. Sie studierte Nordamerikastudien, Betriebswirtschaftslehre und Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin, außerdem mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) an der Boston University. Für ihre Arbeit und ihr Engagement für Studierende der ersten Generation erhielt Katja Urbatsch im Oktober 2018 das Bundesverdienstkreuz am Bande.
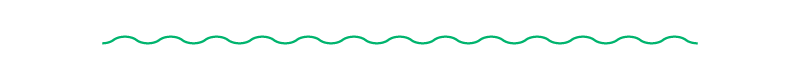
Mehr Interviews bei Zweitausend50
„Staat muss Rahmenbedingungen setzen.“ – Der Ökonom und DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert in Krisen staatliches Handeln – und benennt ein Tabu. Zum Interview
„Schon jetzt ein Bröckeln des Generationenvertrags.“ – der Soziologe Stefan Schulz zur demografischen Zukunft der Bundesrepublik. Zum Interview
„Krisenvorbereitung ist Pflicht, nicht Kür.“ – der Krisenmanager Frank Roselieb zur richtigen Reaktion in schwierigen Situationen. Zum Interview
Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Mobilität“



