Frau Hascher, was hat Sie dazu bewogen, sich mit Rechtsextremismus in ökologischen Bewegungen zu beschäftigen? Welche Rolle spielt dabei die Energie- und Klimapolitik?
Ich bin in einer ländlichen Region in Sachsen aufgewachsen und schon als Jugendliche mit antisemitischen und rechtsextremen Haltungen konfrontiert worden – auch in meinem direkten Umfeld. Als dann 2018 Fridays for Future aufkam und die Klimafrage in den Mittelpunkt rückte, begann ich auch, die Verflechtungen zu sehen: Es geht nicht nur um Technik oder Umwelt, sondern auch um Gerechtigkeit. Wer trägt die Kosten der Energiewende, wer profitiert von neuen Technologien? Das macht Klimapolitik zu einem sozialen Konfliktfeld, das auch rechtsextreme Akteure für sich nutzen.
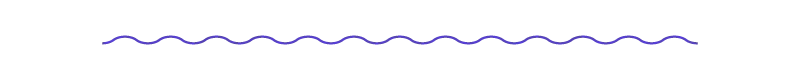
Mehr Interviews bei Zweitausend50
„Schuldenbremse passt nicht mehr ins Hier und Jetzt.“ – der Ökonom Jens Südekum plädiert für eine Anpassung der Schuldenbremse. Zum Interview
„Nur der Staat kann in Krisen Sicherheit bieten.“ – der DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert in Krisen staatliches Handeln – und benennt ein Tabu. Zum Interview
„Schon jetzt ein Bröckeln des Generationenvertrags.“ – der Soziologe Stefan Schulz über die Frage, wie der demographische Wandel unsere Zukunft gefährdet. Zum Interview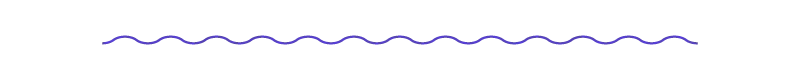
Wie genau tun sie das?
Vor allem über Verschwörungserzählungen. Die Energiewende wird als Projekt einer „Elite“ dargestellt, die angeblich die „einfachen Leute“ ausnimmt. Damit wird nicht nur Klimaschutz schlechtgeredet, sondern auch die Demokratie angegriffen. Politiker erscheinen darin als selbstsüchtig, die Bevölkerung als Opfer.
Gleichzeitig wird ein Kulturkampf konstruiert: hier die „kosmopolitischen Eliten“ in der Stadt, dort die „bodenständigen Leute“ auf dem Land. Dazu kommen Ängste vor vermeintlichen Verboten – kein Auto mehr, kein Fleisch, keine Einfamilienhäuser. Diese Bilder treffen den Alltag vieler Menschen und lassen sich emotional leicht ausschlachten.
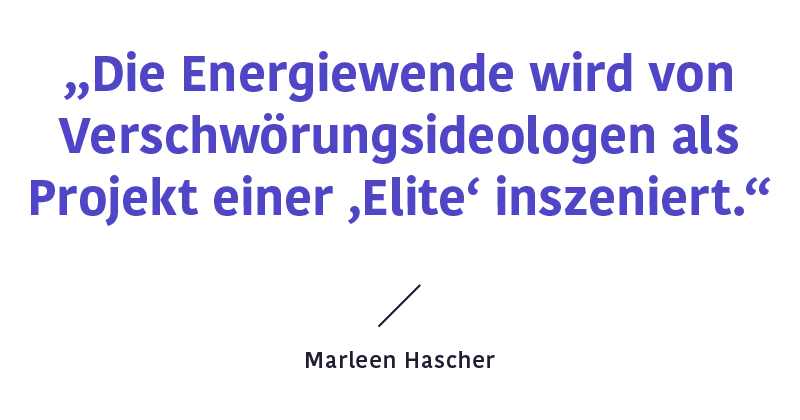
Haben Sie hierzu ein konkretes Beispiel?
In unserer Studie konnten wir beispielsweise zeigen, dass 41,4 Prozent aller Befragten der These zustimmen, der Klimawandel werde als politisches Instrument genutzt, mehr Geld vom Steuerzahler abzupressen. Und die zuvor erwähnten Narrative werden ja laufend auf allen Kanälen verbreitet – von den sozialen Medien über den Stammtisch bis hin zu Redebeiträgen im Bundestag.
Welche Ergebnisse Ihrer Forschung sind für Politik oder Energieunternehmen besonders relevant?
Ein zentrales Ergebnis ist: Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit sind untrennbar miteinander verbunden. Arme Menschen sind weltweit, aber auch in Deutschland, deutlich stärker betroffen. Sie wohnen häufiger an lauten Straßen, sind stärker Feinstaubbelastung ausgesetzt oder können sich gesunde Lebensmittel nicht leisten. Im globalen Süden zeigt sich das in verschärfter Form – etwa, wenn Umweltverschmutzung und Abfall aus Industrieländern dorthin ausgelagert werden und Regionen langfristig unbewohnbar werden. Das führt wiederum zu Fluchtbewegungen.
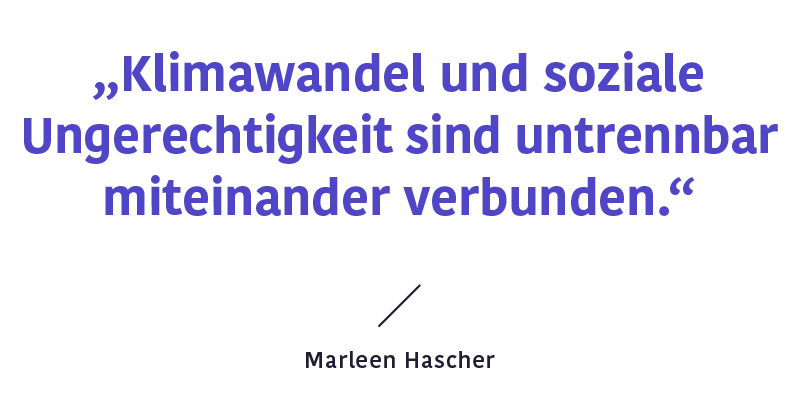
Für Unternehmen heißt das: Klimaschutzmaßnahmen dürfen soziale Ungleichheiten nicht vertiefen. Sie müssen transparent und gerecht gestaltet sein. Ein gutes Beispiel sind Bürgerenergieprojekte, bei denen Anwohnerinnen und Anwohner finanziell beteiligt werden. Das schafft Akzeptanz und widerlegt die rechte Behauptung, die Energiewende sei nur eine Last für die Bevölkerung.
Sie sprechen von einem Kulturkampf zwischen Stadt und Land. Wie äußert sich das?
Gerne wird „Berlin“ zum Feindbild stilisiert – als Sinnbild einer angeblich dekadenten Großstadt, die der ländlichen Bevölkerung etwas „von oben“ aufzwingt. Diese Gegenüberstellung Stadt gegen Land ist typisch für rechtsextreme Narrative. Sie suggeriert: Dort oben die Mächtigen, hier unten die „ehrlichen, einfachen Leute“. Dass solche Bilder auch im Kontext der Energiewende aufgerufen werden, zeigt, wie politisch aufgeladen das Thema ist.
Welche Rolle spielt Bildung in diesem Zusammenhang?
Bildung ist absolut zentral. Allerdings ist in Deutschland der Bildungserfolg von jungen Menschen immer noch sehr stark vom sozialen Status des Elternhauses abhängig. Hier muss Chancengleichheit über sozialpolitische Mahnahmen realisiert werden. Und: Beratungsstellen und Präventionsprojekte – etwa die Fachstelle für Radikalisierungsprävention im Naturschutz – müssen langfristig gesichert sein. Denn rechtsextreme Akteure versuchen immer wieder, Umwelt- und Naturschutzvereine zu unterwandern. Mitarbeitende brauchen Schulungen, um solche Narrative zu erkennen und sich dagegen zu wehren.
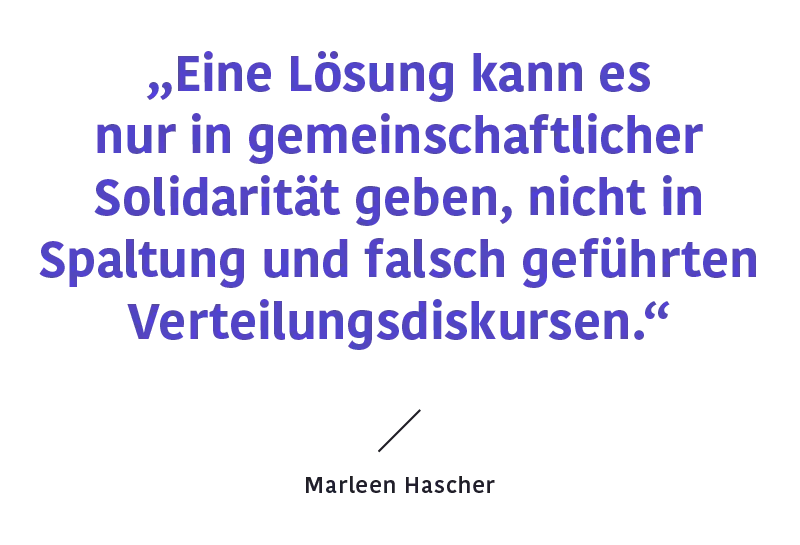
Genauso wichtig ist die Förderung von Medienkompetenz. Junge Menschen, die Fake News erkennen und einordnen können, wirken oft als Multiplikatoren in ihrer Peergroup. Sie geben Skepsis weiter und helfen, rechtsextreme Narrative zu entkräften. Deshalb dürfen soziale Netzwerke nicht verteufelt werden. Stattdessen sollten sie gezielt für demokratische Bildungsangebote genutzt werden – angepasst an Plattformen und Zielgruppen.
Welche Verantwortung haben Energieunternehmen konkret?
Unsere Befragten nannten drei Ebenen der Verantwortung: Politik, Wirtschaft und Individuen. Von Unternehmen wird vor allem erwartet, dass sie ihre Produktionsweisen verändern, CO2-Ausstoß reduzieren und Klimaschutzmaßnahmen ernsthaft umsetzen. Dabei geht es nicht nur um Energiepreise, sondern auch um Glaubwürdigkeit und Transparenz.
Besonders wirksam ist, wenn Unternehmen Bürgerinnen und Bürger, aber auch ihre Mitarbeitenden beteiligen -sei es finanziell oder durch Mitsprache. Das stärkt Vertrauen und zeigt: Energiewende ist kein Projekt gegen die Bevölkerung, sondern mit ihr.
Zum Schluss: Sind Sie optimistisch, dass die ökologische Transformation ein verbindendes Moment werden kann?
Ich bin eher vorsichtig. Der Klimawandel betrifft alle Menschen – vor allem aber die sozial Schwachen. Eine Lösung kann es nur in gemeinschaftlicher Solidarität geben, nicht in Spaltung und falsch geführten Verteilungsdiskursen. Wichtig ist, antisemitischen und rechtsextremen Narrativen das Wasser abzugraben und klarzumachen, dass sie nichts mit der Realität zu tun haben. Wenn das gelingt, kann die Transformation tatsächlich gelingen – aber der Weg dorthin ist noch lang.
Marleen Hascher (M. A.)
ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitete von 2023 bis 2024 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Rechtsextremismus in ökologischen Transformationsräumen (Link) am Institut für demokratische Kultur an der Hochschule Magdeburg-Stendal, wo sie derzeit zum Thema Antisemitismus in ökologischen Bewegungen promoviert. Im November erscheint die Monografie „Jugend. Klima. Rechtsextremismus“ (Link) im Verlag Barbara Budrich, als PDF auch kostenlos erhältlich. Haschers Arbeitsschwerpunkte sind Antisemitismus, Verschwörungserzählungen, Rechtsextremismus, Ostdeutschlandforschung und Kritische Theorie.
Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Gleichgewicht“


